Teresa
Member
Unsere Geschichte
Jetzt - nach nunmehr über anderthalb Jahren, nachdem uns die Diagnose „Rett-Syndrom“ mitgeteilt wurde, - schaffe ich es endlich, unsere Geschichte aufzuschreiben. Ich habe deswegen ein relativ schlechtes Gewissen, haben sich in der Zwischenzeit doch viele andere, die erst nach uns zur „Rett-Familie“ gestoßen sind, längst gemeldet und über sich und ihre Engelchen berichtet. Aber die Umstände waren in unserem Falle jedenfalls so gestrickt, dass es uns erst jetzt möglich ist, in dieser Weise zurückzublicken.
Bis zur Geburt unserer Tochter Teresa verlief unser Leben - aus jetziger Sicht - recht langweilig. Wir, Uli (inzwischen 41) und ich (inzwischen 43), waren bis dahin sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Als Erzieherin und Heilpädagogin hatte zwar Uli seit jeher ein inniges Verhältnis zu Kindern. Den eigenen Kinderwunsch - so beurteile ich dies jedenfalls aus heutiger Sicht - verdrängte sie schon deshalb über viele Jahre, weil ich mich damals stets als überzeugter „Kinderfeind“ bekannte. Nahezu in den gesamten ersten vier Jahrzehnten meines Lebens vermochte ich eine positive Vorstellung über Familie nicht zu entwickeln. Dies änderte sich erst, als mir beruflich ein letzter planbarer Aufstieg gelungen war. Ich hatte damals irgendwie das Gefühl, mir selbst nichts mehr zu schulden, mir auch selbst nicht mehr zu genügen. Diese Umstände veränderten schlagartig mein Verhältnis zu mir selbst. Es wollte vielleicht der Zufall, dass gerade zu dieser Zeit meine (jüngere) Schwester Mutter geworden war. Dieses Ereignis mag den Perspektivenwechsel zwar nicht ausgelöst, so ihn doch möglicherweise beschleunigt haben. Hinzu kam, dass meiner Frau Uli, nachdem sie kurz zuvor eine zweite Berufsausbildung erfolgreich durchlaufen hatte, klar wurde, dass jegliche Möglichkeiten beruflicher Selbstverwirklichung den in der Vergangenheit stets geleugneten Kinderwunsch nicht ersetzen konnten. Beim Einsetzen dieses Sinneswandels waren wir bereits 38 bzw. 36 Jahre alt. Als sich dann schließlich der - sehnlichst gewünschte Nachwuchs -ankündigte, waren wir beide sehr glücklich. Die Zeit der Schwangerschaft meiner Frau habe ich als die harmonischste Zeit unserer Ehe in Erinnerung. Mit Ausnahme nur punktueller Ereignisse (Ringelröteln in der Schule, in der meine Frau arbeitete, und Amniozentese) war die Schwangerschaft von keinen negativen Umständen begleitet. Dementsprechend gab es weder Komplikationen noch Auffälligkeiten im Verlauf. Nahezu keine Vorsorgeuntersuchung ließen wir aus. Bei keiner dieser Untersuchungen ergaben sich aus schulmedizinischer Sicht Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Behinderung oder Krankheit. Eine solche Möglichkeit schien sogar ausgeschlossen, nachdem auch die Amniozentese keinen auffälligen Befund ergeben hatte.
Als unsere Tochter am 21. Februar 2003 in Weimar per Kaiserschnitt zur Welt kam, stellten die behandelnden Ärzte sofort Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Atmung (Apnoen) fest, die sie diagnostisch nicht einzuordnen vermochten. Auffällig war im selben Zusammenhang, dass Teresa unmittelbar nach der Entbindung kaum schrie; auch in den darauffolgenden Stunden und Tagen gab sie selten einen Laut von sich. Vorsorglich erhielt Teresa am ersten Tag nach der Geburt eine Sauerstoffvorlage. Angesichts der stark ausgeprägten periodischen Atmung war Teresa an ein Gerät zur Kontrolle des Sättigungsgrads des aufgenommenen Sauerstoffes angeschlossen. Innerhalb der ersten Tage konnten die Ärzte zwar so gut wie gar nichts diagnostizieren, andererseits aber auch nichts - zu unserer Beruhigung - ausschließen. Wegen des Verdachts auf das Vorliegen einer ernsthaften Infektion wurde unserem Kind schon am ersten Lebenstag ein Antibiotikum verabreicht. Eine nur unzureichende Ausbildung der Lunge und das Vorliegen eines Loches im Herz konnten erst nach einigen Tagen ausgeschlossen werden. Die schon damals auffällige hypotone Muskulatur des Kindes konnten die Ärzte nicht erklären. Zur Beobachtung musste Teresa 14 Tage lang in der Neonatologie des Krankenhauses verbringen. Weil auch danach die Unregelmäßigkeiten bei der Atmung nicht eingeordnet werden und die Ärzte das Risiko eines „plötzlichen Kindstodes“ nicht ausschließen konnten, wurde Teresa in ein anderes Krankenhaus (Apolda) zur besonderen Beobachtung ihres Schlafverhaltens (Schlaflabor) überwiesen. Nachdem man sie dort 3 Tage lang beobachtet hatte, ohne dass die Ärzte eine Diagnose stellen konnten, durfte sie endlich zu uns nach Hause - wir wohnten damals noch in Stadtroda (Thüringen) -. Erst ab diesem Zeitpunkt begann für uns der normale Familienalltag. Ich hatte mir damals zwei Wochen Urlaub genommen, um die ersten Tage und Nächte zusammen mit unserem Kind richtig erleben zu können. Schon in den Krankenhäusern nahm Teresa jeden Tag geringe Mengen von - in Flüssigkeit aufgelöstem - Coffeinpulver mit den Mahlzeiten zu sich. Wir selbst setzten zuhause diese Verabreichungen auf Empfehlung der Ärzte zunächst fort. Später, als Teresa ca. 15 Monate alt war, setzten wir, zumal zwei zwischenzeitlich erfolgte Nachuntersuchungen im Schlaflabor keinen weiteren Aufschluss ergeben hatten, das Coffein langsam wieder ab.
Die Nächte waren in den ersten Lebensmonaten - so denke ich jedenfalls aus heutiger Sicht - nicht anstrengender als bei einem sogenannten gesunden Kind. Teresa machte - sowohl für uns als auch für andere - insgesamt den Eindruck eines sehr glücklichen und zufriedenen Babys. Kurz vor ihrer Geburt hatten wir einen Camcorder gekauft, mit dem wir bis heute die gesamte Entwicklung von Teresa begleitet und festgehalten haben. Währen der ersten Lebensmonate verlief diese Entwicklung - wie bei den meisten Rett-Mädchen auch - aus damaliger Sicht im Wesentlichen unauffällig. Als positiv registrierten wir, dass Teresa Gegenstände sehr ruhig und lange beobachten und sich an ihnen außerordentlich erfreuen konnte. Die Aufmerksamkeit unserer Tochter schien gut entwickelt zu sein. Das Interesse des Kindes sich fortzubewegen, schien indessen überhaupt nicht zu bestehen. Lange versuchte sie nicht einmal zu robben. Seltsam fanden wir von Anfang an, dass Teresa manchmal geradezu körperlich erstarrte. Sie wurde in diesen Augenblicken regungslos und blickte regelrecht ins Leere. Gelegentlich befürchtete meine Frau in solchen Momenten, das Kind könnte nicht mehr leben. Auffällig war weiterhin, dass Teresa bei grundsätzlich hypotoner Muskulatur in bestimmten Situationen, insbesondere beim Trinken ihrer Milch aus der Flasche, sich so sehr verkrampfte, dass sie richtig steif wurde.
Jedenfalls ungefähr ab dem 9. Lebensmonat entwickelte sich Teresa in motorischer Hinsicht langsamer als andere Kinder. Etwa mit 8 Monaten drehte sie sich aus der Rücken- in die Bauchlage und umgekehrt. Das freie Sitzen erlernte sie ungefähr im Alter von 8 bis 10 Monaten. Während wir das auf die Geburt von Teresa folgende erste Weihnachtsfest (2003) noch unbeschwert von Sorgen erleben durften, waren wir zum Zeitpunkt ihres ersten Geburtstags (am 21. Februar 2004) etwas bedrückt, mussten wir doch feststellen, dass Teresa nicht einmal Ansätze zum Krabbeln zeigte, sondern, wenn sie auf dem Bauch lag, sich in die Richtung, in die sie schauen wollte, lediglich mit ihren Händen drehen konnte. Sie war lediglich in der Lage, sich - auf dem Bauch liegend - um einen bestimmten Punkt herum zu drehen. Der Umstand, dass sie zu diesem Zeitpunkt gelegentlich mehrsilbige Wörter aussprach, konnte uns die Verunsicherung nicht nehmen. Erst im Alter von ca. 15 Monaten konnte sie richtig robben. Von Krabbeln im eigentlichen Sinne war auch zu diesem Zeitpunkt nichts erkennbar. Allerdings konnte sie damals die Wörter „Mama“, „Papa“ und „da“ aussprechen und erfasste ebenso den Bedeutungsinhalt dieser Begriffe. Wenn ich ihr ein Bild zeigte, auf dem außer mir andere Personen zu sehen waren, sagte sie, wenn ich den Finger unkommentiert auf mich selbst richtete, spontan „Papa“. Wenn sie ihrerseits auf einen Gegenstand zeigte, dem ihr Interesse galt, sagte sie „da“.
Als Teresa ca. 16 Monate alt war, wandten wir uns wegen ihrer motorischen Beeinträchtigungen vorsorglich an einen Orthopäden (in Weimar). Wir hielten es wegen eines früheren Hüftleidens meiner Frau Uli in deren ersten zwei Lebensjahren nicht für ausgeschlossen, dass die Ursache für die nach unserer Einschätzung nur schwach entwickelte Mobilität von Teresa in einem „ererbten“ Hüftschaden lag. Der aufgesuchte Arzt zerstreute diese Bedenken anhand einer Röntgenaufnahme. Bedauerlicherweise konnte er sich die Bemerkung, wir sollten uns an einen Neurologen wenden, zumal - angesichts der Physiognomie des Kindes - ein Down-Syndrom vorliegen müsse, nicht verkneifen. Er sagte wörtlich: „Natürlich ist dafür ein Neurologe zuständig. Dies ist ein Down-Syndrom. Das sieht man doch.“ Diese von wenig Einfühlsamkeit zeugende Formulierung schockierte und verärgerte uns beide gleichermaßen. Es war das erste Mal, dass wir mit einem solchen Verdacht konfrontiert waren. Er lag für uns schon deshalb fern, weil die Fruchtwasseruntersuchung keinen auffälligen Befund ergeben hatte.
Ein zweites Mal wurden wir ärztlicherseits mit einem entsprechenden Verdacht konfrontiert, als Teresa ca. 18 Monate alt war. Es war gerade Hochsommer; während eines Ausfluges nach Jena an einem Sonntagnachmittag wurde Teresa von einer Wespe gestochen und schrie fürchterlich. Da dies „glücklicherweise“ in räumlicher Nähe zur Kinderklinik des Universitätsklinikums passierte, fuhren wir sie auf dem schnellsten Wege dorthin. Der zu diesem Zeitpunkt als einziger anwesende Assistenzarzt stellte mehrere Fragen zu Vorerkrankungen und zum bisherigen Entwicklungsverlauf. Er wunderte sich darüber, dass Teresa noch nicht laufen konnte. Er erklärte, dass nach seiner Auffassung ein Down-Syndrom (in Mosaik-Form) - ungeachtet der Ergebnisse der vorgeburtlichen Untersuchungen - nicht auszuschließen sei. Die Art, in der er sein diesbezügliches Interesse zum Ausdruck brachte, zeugte ebenfalls von wenig Einfühlungsvermögen. Eine gewisse Faszination über den „Fall“ war ihm ersichtlich anzumerken. Geradezu mit wissenschaftlichem Enthusiasmus warb er dafür, unsere Tochter in der Kinderklinik insbesondere neurologisch untersuchen zu lassen; in diesem Falle würde man sicherlich „etwas bei ihr finden“. Sein menschlich unreifes Verhalten - man hatte den Eindruck, man habe einen Medizinstudenten im ersten Semester vor sich, der aus eigener Profilierungssucht alle denkbaren Schreckensbilder aufzeigen wollte - entsetzte uns. Ich selbst fand dieses Auftreten angesichts der emotionalen Betroffenheit von Eltern derart unangemessen, dass ich ihn darauf hinwies. Er zeigte sich daraufhin irritiert und verstummte fast.
Etwas später - etwa im Alter von 18-20 Monaten - fing Teresa zu unserer Freude an zu krabbeln. Der Bewegungsablauf wurde dabei allmählich sicherer und schneller. Mit ca. 20 Monaten schaffte sie es immerhin, vom Fußboden aus auf ein ca. 40 cm hohes Trampolin zu krabbeln. Ihre Sprache entwickelte sich indessen nicht weiter. Zu beobachten war, dass sie - häufig vor dem Spiegel - Selbstgespräche in einer dem Anschein nach eigenen Sprache zu führen schien. Der aktive Sprachschatz erweiterte sich nicht. Auffällig war, dass sie ungefähr ab dem 20. Lebensmonat die Wörter „Mama“ und „Papa“ immer seltener aussprach. Im Alter von ca. 2 Jahren gelang es ihr, sich in ihrem Bettchen aus dem Sitzen in den Stand hochzuziehen. Entsprechendes war ihr an einem kleinen Tisch möglich, an dem sie sich anschließend auch festhalten konnte. Häufig saß sie damals auch auf einem kleinen Stühlchen an diesem Tisch und malte mit bunten Stiften auf Papier. Aufgrund der bis dahin stetigen, wenn auch verzögerten motorischen Entwicklung waren wir trotz schon damals vorhandener Sorgen doch immer noch zuversichtlich. Der Gedanke an eine gravierende Behinderung lag jedenfalls noch fern. Im Hinblick auf die erwähnten unbedachten Äußerungen bestimmter Ärzte dachten wir lediglich an die Möglichkeit einer abgeschwächten Ausprägung des Down-Syndroms, hielten aber auch dies schon in Ansehung der Physiognomie unserer Tochter und der übrigen fehlenden typischen körperlichen Merkmale für unwahrscheinlich.
Ungefähr ab Vollendung ihres 2. Lebensjahres stagnierte die motorische Entwicklung. Die aktiven sprachlichen Fähigkeiten, die sich bis dahin auf nur ganz wenige Wörter bezogen hatten, bildeten sich sogar zurück. Etwa im Alter von 26 Monaten begann Teresa, - für uns zunächst nicht einzuordnende - Handstereotypien („Zupfen“) und immer stärker autistisch wirkende Verhaltensmuster zu entwickeln. Ab diesem Zeitpunkt krabbelte sie auch weniger. Die Handstereotypien prägten sich immer stärker aus. Angesichts der bei Teresa eingetretenen Entwicklungsstagnation und des immer größer gewordenen Abstandes zum Entwicklungsniveau anderer Kinder ihres Alters fingen meine Frau und ich an, ernsthaft darüber nachzudenken, ob dem atypischen Entwicklungsverlauf nicht doch eine bestimmte Behinderung unserer Tochter zugrunde liegen könnte. Alle bis dahin unternommenen Versuche, das Entwicklungsdefizit mit den Methoden von Ostheopathie, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Bioresonanztherapie auch nur ansatzweise auszugleichen, stellten sich jetzt als nicht mehr erfolgversprechend dar. Wir entschlossen uns deshalb, Teresa zunächst grundlegend schulmedizinisch, insbesondere neurologisch, untersuchen zu lassen. Getragen war dieser Entschluss vor allem von unserem Wunsch, frühzeitig und nicht erst in einigen Jahren die Ursache für den bis dahin nicht erklärlichen Entwicklungsverlauf von Teresa zu erfahren. Dahinter stand nicht nur unser Anliegen, gegebenenfalls rechtzeitig die jeweils geeignete Therapie einleiten zu können. Wir gingen auch davon aus, dass wir uns um so schneller auf eine etwaige Behinderung einstellen, damit abfinden und gegebenenfalls Energieverluste vermeiden können, je früher die Krankheit diagnostiziert werden würde. Mit Energieverlusten hatten wir bereits über einen längeren Zeitraum Erfahrungen gemacht. Nicht nur die Vielzahl der bereits erwähnten Therapiemaßnahmen, die Teresa von Geburt an durchlaufen hatte und die Uli als Begleit- und Betreuungsperson immer stärker auch körperlich beansprucht hatten, begannen, Spuren der Erschöpfung zu hinterlassen. Der Wechsel zwischen immer wieder neu geschöpfter Hoffnung und wiederholten Frustrationen - etwa wenn wir sahen, wie sich andere gleichaltrige Kinder bewegten - entfaltete eine immer stärker werdende Demoralisierungswirkung und vertiefte sukzessive unseren Schmerz.
Zunächst stellten wir Teresa (am 22. April 2005) einer noch jungen Kinderärztin im Sozialpädiatrischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena vor. Diese empfahl uns eine mehrtägige stationäre Untersuchung in der neuropädiatrischen Abteilung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Nach anfänglichen Bedenken entschieden wir uns für einen stationären Aufenthalt. Da ein Teil der Untersuchungen auf unser Drängen hin ambulant (am 16. und 17. Mai 2005) durchgeführt wurden, dauerte der anschließende stationäre Aufenthalt drei Tage (vom 18. bis 21. Mai 2005). Teresa durchlief dabei das neuropädiatrische Standardprogramm sowie weitere Untersuchungen (auf bestimmte Stoffwechselstörungen).
An einem der Abende während des stationären Aufenthaltes betrat eine noch junge Krankenschwester (Simone) das Zimmer, in dem Teresa zusammen mit Uli - als Begleitperson - untergebracht war. Ich weiß inzwischen nicht mehr, ob wir damals Wote miteinander wechselten; wahrscheinlich war dies nicht der Fall. Ich weiß heute nur noch, dass ich - erschöpft von den Anspannungen des Tages - auf einem Stuhl saß und mir beim Anblick der jungen, frisch wirkenden Frau spontan ein seltsamer Gedanke durch den Kopf schoss: „Vielleicht waren wir einfach zu alt, um ein gesundes Kind zu bekommen. Diese Frau ist zu beneiden. Sie wird Probleme, wie wir sie haben, nicht kennen.“ Wie falsch man gelegentlich liegt! Als ich am darauffolgenden Samstagmorgen nach Abschluss der Untersuchungen Teresa und Uli aus der Klinik abholte und nach Hause fuhr, erzählte Uli, sie habe sich sehr nett mit der besagten Krankenschwester unterhalten. Diese sei von Teresa entzückt gewesen und habe, als sie gesehen habe, wie Teresa in ihrem Bettchen herumgeturnt und sich am Bettgitter hochgezogen habe, gesagt: „Ihre Tochter ist ja richtig fit. So etwas kann meine kleine Lilly nicht.“ Auf Frage meiner Frau, was ihrer - etwa gleichaltrigen - Tochter denn fehle, habe sie geantwortet, sie wisse dies nicht, ihre Tochter sei jedenfalls behindert. Als ich dies hörte, plagte mich wegen meiner Gedanken vom Vortag ein schlechtes Gewissen.
Ungefähr im Sommer 2005 ging das aktive Sprachvermögen im engeren Sinne vollends verloren; Teresa sprach fast kein einziges Wort mehr. Nach Durchführung der Untersuchungen, noch vor Auswertung der Ergebnisse, verbrachten wir gemeinsam zu dritt einen Urlaub in Dänemark, um nervlich etwas zu entspannen. In dieser Zeit fing ich an, immer stärker daran zu glauben, dass die Entwicklungsbeeinträchtigung von Teresa eine neurologische Ursache haben müsse; mir fiel auf, dass ihre Zunge sehr stark zitterte, wenn sie beim Essen den Mund öffnete.
Die Ergebnisse der im Universitätsklinikum Jena durchgeführten Untersuchungen wurden uns erst ca. anderthalb Monate später - in einem Gespräch mit dem Direktor der Neuropädiatrischen Abteilung und des Sozialpädiatrischen Zentrums (Prof. Dr. Ulrich Brandl) sowie mit Frau Dr. Küchler, einer auf humangenetische Fragen spezialisierten Ärztin, (am 5. Juli 2005) - mitgeteilt. Hiernach war insbesondere eine therapierbare Stoffwechselerkrankung im herkömmlichen Sinne auszuschließen. Als pathologisch auffällig bezeichneten die Ärzte indessen den Befund eines bereits im Mai durchgeführten Mittagsschlaf-EEG. Sie äußerten die Auffassung, dass diese Ergebnisse auf ein noch nicht bestimmbares Krankheitsbild mit möglichen Anfallsleiden hinweisen könnten; bei einer Gesamtbetrachtung aller Auffälligkeiten sei bei Teresa am ehesten noch von einer autistischen Störung auszugehen. Als Therapiemaßnahmen empfahlen sie vorerst nur die Fortführung von Physiotherapie und die Anwendung von Logopädie. Zugleich sollte die Entwicklung von Teresa aufmerksam weiter verfolgt werden. Vor den Schlussbemerkungen verständigte sich Prof. Dr. Brandl mit seiner Kollegin in gewollt unauffälliger Form durch bestimmte Andeutungen darüber, ob er einen bis dahin nicht ausgeräumten Verdacht uns gegenüber erwähnen sollte. Sie signalisierte ihm, dass sie die Erörterung - wohl angesichts der Verhaltensmuster von Teresa, die bei diesem Gespräch anwesend war und bereits charakteristische Handstereotypien zeigte - für geboten hielt. Er sprach das Thema „Rett-Syndrom“ an, von dem wir beide bis dahin noch nie gehört hatten, und beschrieb das Krankheitsbild zwar knapp und korrekt, aber in einer Weise, die den möglichen Schweregrad der Behinderung bei weitem nicht erahnen ließ. Er gab sich - aus heutiger Sicht - also sehr viel Mühe, uns das Thema langsam und schonend nahe zu bringen. Zudem stellte er die Verdachtsdiagnose „Rett-Syndrom“ als - gegenüber einer autistischen Störung - weniger wahrscheinlich dar. Weiteren Aufschluss könne insoweit nur eine molekulargenetische Untersuchung bringen, für die es einer gesonderten Einwilligung und einer entsprechenden Kostenübernahmeerklärung unsererseits bedürfe. Da wir auch insoweit Klarheit erreichen wollten, willigten wir sofort ein. Nach Beendigung dieses Gesprächs fühlten wir uns zunächst erleichtert, weil uns die Auswirkungen des Rett-Syndroms im einzelnen nicht bekannt waren, zumal sich die Ärzte - wohl bewusst - auf nur vage Angaben beschränkt hatten. Hinzu kam, dass meine Frau und ich, als wir im Rahmen des genannten Gesprächs zum ersten Mal vom Rett-Syndrom hörten, zunächst lediglich an das im häufiger bekannte „Tourette-Syndrom“ dachten, eine deutlich weniger gravierende Diagnose, die wir angesichts der Verhaltensmuster unserer Tochter auch ohnehin nur für theoretisch möglich hielten.
Wir fühlten uns in den darauffolgenden Tagen beide so leicht (im Kopf) wie lange nicht mehr - ein Gefühl, das wir aufgrund der ständigen Sorgen bereits seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr erlebt hatten und das uns deshalb inzwischen nahezu fremd geworden war -. Dieser Zustand sollte jedoch nicht sehr lange andauern. Nur etwa zwei Tage nach diesem Gespräch registrierte ich, dass sich die positive Stimmung meiner Frau etwas gedämpft hatte. Diese Verstimmung war aus meiner Sicht jedoch nicht so stark, dass für mich Veranlassung bestand, Uli darauf anzusprechen. Zwei weitere Tage später (am 9. Juli 2005, einem Samstag) warf ich einen Blick in das Klinische Wörterbuch „Pschyrembel“ (258. Auflage 1998) und las unter dem Stichwort „Rett-Syndrom“. Was dort geschrieben stand, ging erheblich über die entsprechenden Andeutungen der Ärzte hinaus und beunruhigte mich ein bisschen, zumal Teresa schon zur damaligen Zeit einen Teil der beschriebenen Symptome zeigte. Noch am selben Tag sprach ich Uli auf das Thema an und fragte sie, ob sie Näheres über das Rett-Syndrom wisse. Uli erzählte mir daraufhin, dass sie zwischenzeitlich im Internet recherchiert habe; das, was sie dort über das Krankheitsbild gelesen habe, habe sie deprimiert, weil ein beträchtlicher Teil der beschriebenen Symptome bei Teresa zutreffe. Diese Antwort steigerte meine innere Unruhe und veranlasste mich sofort, ebenfalls im Internet zu recherchieren. Ich wurde dort sehr schnell fündig. Auf welcher Internet-Seite ich damals was im Einzelnen gelesen habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Die Informationen waren jedenfalls eindeutig in Bezug auf die Schwere des Krankheitsbildes. Ich fühlte mich in diesem Moment von innerem Entsetzen überwältigt, zumal ich aufgrund der Ausführungen zur Symptomatik es jetzt als nicht mehr fernliegend einschätzte, dass bei Teresa dieses Krankheitsbild diagnostiziert werden könnte. Als ich Erlebnisberichte betroffener Eltern las, traten mir Tränen in die Augen. Ich war innerlich so niedergeschlagen wie lange nicht mehr. Ich fragte meine Frau, weshalb sie, nachdem sie als erste die Ausführungen gelesen hatte, mich nicht ihrerseits sofort auf das Thema angesprochen habe. Sie antwortete, sie habe mich nicht beunruhigen wollen. Im Verlaufe der darauffolgenden Wochen waren wir gedanklich ständig bei der noch ausstehenden Diagnose, zumal uns diese schon in wenigen Wochen eröffnet werden sollte. Trotzdem hatte ich während dieser Zeit überwiegend das Gefühl, dass das Rett-Syndrom bei unserer Tochter nicht diagnostiziert werden würde; bislang hatten wir trotz mancher Unbequemlichkeiten in unserem Leben letzten Endes immer wieder Glück gehabt und waren von Schicksalsschlägen stets verschont geblieben. Schon deshalb konnte man sich damals noch nicht richtig vorstellen, dass es einen selbst diesmal „wirklich hart“ treffen könnte. Andererseits war ein Fortschritt in der motorischen Entwicklung von Teresa nun seit längerer Zeit nicht mehr zu beobachten. Vielmehr hatten wir den Eindruck, dass sich ihre Motorik sogar zurückentwickelte; dies galt namentlich für den willensgesteuerten Einsatz ihrer Hände. Das nicht endende Wechselbad von Hoffen, Bangen und Verarbeitung von Frustrationen ging in dieser Zeit bei uns beiden immer stärker an die Substanz. Zu meiner eigenen Frustration trug schließlich die Einschätzung bei, dass selbst dann, wenn das Rett-Syndrom bei Teresa nicht diagnostiziert werden würde, eine andere - möglicherweise nicht weniger gravierende - Behinderung vorläge, für die es noch keine Bezeichnung gäbe. Gewissheit über die Auswirkungen einer namenlosen Krankheit erst irgendwann einmal - nach weiteren Kräfte zehrenden Jahren - zu erlangen, stellte sich als nicht wesentlich bessere Alternative dar.
Am Mittwoch, dem 24. August 2005, rief mich Frau Dr. Küchler auf der Dienststelle an und teilte mir endlich mit, dass die Ergebnisse der molegulargenetischen Untersuchung vorlägen. Sie stellte mir zwei Besprechnungstermine zur Auswahl: Freitag, 26. August oder Montag, 29. August. Ich entschied mich für den früheren Termin. Die Nervosität wurde auf unserer Seite jetzt immer größer. Dem Umstand, dass die Ärztin davon abgesehen hatte, mir bereits am Telefon eine Information zukommen zu lassen, maß ich keine Bedeutung bei. Uns war bereits von den ersten Untersuchungen her bekannt, dass entsprechende Untersuchungsergebnisse - unabhängig vom (positiven oder negativen) Inhalt - grundsätzlich nicht fernmündlich übermittelt werden. Trotzdem waren leichte Zweifel bei mir entstanden, ob das Absehen von einer beruhigenden Andeutung der Ärztin nicht doch als schlechtes Zeichen gewertet werden musste. Bei dem vereinbarten Termin (am Morgen des 26. August im Sozialpädiatrischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena) war Teresa nicht anwesend. Das Gespräch führten wieder Prof. Dr. Brandl und Frau Dr. Küchler. Wir wurden im Wartezimmer von beiden persönlich abgeholt und in einen Besprechungsraum geführt. Kurz nachdem wir Platz genommen hatten, kam Prof. Dr. Brandl - entgegen seiner für ihn sonst typischen langatmigen Ausführungen - sehr schnell auf den Punkt, so schnell, dass ich mir innerlich fast „überrannt“ vorkam. Soweit ich mich jetzt noch erinnere, verzichtete er auf jegliche einleitenden Worte. Er sagte ungefähr wörtlich: „Also es hat sich doch bestätigt“. Bei mir bestand in diesem Moment völlige Unklarheit in allen Richtungen - bei meiner Frau dürfte es ebenso gewesen sein -. Die weiteren Ausführungen von Prof. Dr. Brandl zur festgestellten Mutation erhellten sehr schnell den Inhalt seiner These: die jeden Zweifel ausschließende Bestätigung der Diagnose „Rett-Syndrom“. Ich hatte den Eindruck, dass meine Frau erst in dem Moment, in dem der Arzt den Begriff „Rett-Syndrom“ aussprach, wirklich den Inhalt des uns mitgeteilten Untersuchungsergebnisses erfasste, verstehen wollte, konnte, musste. Ab diesem Moment konnten wir beide den Ausführungen des Arztes kaum noch folgen. Ich überlegte deshalb, ob ich um eine Gesprächspause bitten sollte, denn ich hatte das Gefühl, dass ich zunächst nach Luft schnappen und mir erst einmal den Schmerz aus der Seele herausbrüllen müsste. Meiner Frau ging es ähnlich. Unter Hinweis auf meine nur noch beschränkt vorhanden gewesene Aufnahmefähigkeit bat ich darum, das Gespräch auf das unbedingt Notwendige zu beschränken und Einzelheiten einer späteren Unterredung vorzubehalten. Dementsprechend stellten wir nur noch wenige Fragen. Prof. Dr. Brandl fiel es ersichtlich schwer, uns die Diagnose mitzuteilen; schon an dieser Stelle sei angemerkt, dass die persönliche Anteilnahme ihm sogar später noch - ca. ein Jahr nach der Diagnose - bei einer erneuten Besprechung (am 5. September 2006) anzumerken war. Es mag eigenartig klingen, aber ich dachte, als Prof. Dr. Brandl uns das Ergebnis der molekulargenetischen Untersuchung mitgeteilt hatte, daran, wie unangenehm es für ihn selbst sein müsse, uns dies alles zu erklären. Seine Situation erinnerte mich sehr stark an diejenige, in der ich mich nicht selten befand, wenn ich von Berufs wegen einem Asylbewerber verdeutlichen musste, dass er nach einem über viele Jahre dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet in sein Herkunftsland, zu dem er keinerlei Bindungen mehr hatte, werde zurückzukehren müssen. Die Einlassungen von Herrn Prof. Dr. Brandl signalisierten echte gefühlsmäßige, nicht nur gespielte Anteilnahme. Eine solche war bei der Assistenzärztin weniger festzustellen. Sie konfrontierte uns noch im Verlaufe des Gesprächs mit - selbst nach Auffassung des Professors völlig überflüssigen - Erklärungsvordrucken, die wir - im Hinblick auf die privatärztliche Behandlung unserer Tochter - schnell noch unterschreiben sollten, um eine Abrechnung über eine externe Verrechnungsstelle zu ermöglichen. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr nur darum ging, überobligatorisches Engagement gegenüber dem Professor zu demonstrieren und sich dadurch zu profilieren. Dieser Profilierungsversuch schlug indessen gründlich fehl. Denn der Professor reagierte schon in unserer Gegenwart außerordentlich ungehalten auf das streberhaft anmutende Verhalten seiner Kollegin. In unserem Beisein kritisierte er sie und forderte sie auf, uns „jetzt nicht in dieser Situation mit solchem bürokratischen Mist zu belästigen“.
Als wir endlich das Gebäude des Sozialpädiatrischen Zentrums verlassen hatten, nahmen wir uns - noch vor der Eingangstür - gegenseitig in die Arme und klammerten uns aneinander krampfhaft fest, um uns gegenseitig zu stützen. Der Schmerz, den man in solch einem Augenblick in sich spürt, ist unbeschreiblich. Wenn die Vorstellung, ein gesundes Kind zu haben, durch eine entsprechende Diagnose endgültig zerstört wird, stirbt einem ein Teil dieses Kindes weg. Auch wenn einen die Eröffnung einer solchen Diagnose nicht völlig unvorbereitet trifft, weil man sie schon vorher für möglich gehalten und sich gedanklich damit auseinander gesetzt hat, bedeutet sie doch, dass sie in diesem Moment als unwiederbringlicher, endgültiger Verlust einer Beziehung empfunden wird. Diffuse Schuldgefühle gingen mir durch den Kopf. Die bloße rationale Erkenntnis, dass man sich selbst nichts - rein gar nichts - insoweit vorzuwerfen hat, ist in der Situation nicht weiter führend. Sie ändert nichts an dem vagen Eindruck, für die Behinderung des eigenen Kindes - und sei es auch nur im Sinne einer „conditio sine qua non“ - verantwortlich zu sein. Vielleicht entspringt dieses - rational nicht begründbare - Gefühl einem Bedürfnis des Menschen, eine Erklärung dafür zu finden, weshalb ausgerechnet das eigene Kind dasjenige unter 10.000 oder 15.000 Mädchen sein soll, das vom Rett-Syndrom betroffen ist. Obwohl man schon vorher allmählich immer „bösgläubiger“ geworden ist und deshalb mit der Diagnose gerechnet hat, tut man sich sehr schwer, es dann, wenn endgültige Gewissheit eintritt, auch zu glauben und als gegeben hinzunehmen. Man hat in dieser Situation das Gefühl, dass Verstand und Gefühl nicht mehr zueinander passen, sozusagen auseinander driften. Was tut man in einer solchen Situation? Die Menschen sind so unterschiedlich, dass alle unterschiedlich reagieren, und auch unterschiedlich reagieren müssen, schon um die ersten Minuten nach dem Verlust zu überstehen. Es wäre deshalb verfehlt, aus einer „ex-post“-Betrachtung der eigenen Betroffenheit heraus für andere vorbeugend Verhaltensempfehlungen oder Handlungsstrategien für diese ersten Minuten entwickeln zu wollen. Was machten wir in der Situation ? Wir setzten uns ins Auto und fuhren ohne Ziel planlos durch die Gegend. Während der Fahrt überlegten wir nur: „Wohin sollen wir fahren? Jetzt einfach nach Hause fahren wollen wir jedenfalls nicht.“ Unterwegs rief Uli per Handy Mutter und Schwiegermutter an und informierte sie beide über die Diagnose. An einer Autobahnraststätte hielten wir an. Ich glaube, es war das erste und bislang einzige Mal in meinem Leben, dass ich an einem Werktagmorgen - noch dazu auf nüchternen Magen - eine Flasche Bier trank. Der Zustand der Betäubung, in den ich dadurch sehr schnell flüchten konnte, verschaffte mir die in diesem Moment dringend benötigte seelische Verschnaufpause. Zuhause angekommen holten wir zunächst Teresa bei unserer Nachbarin (Frau Klopfleisch) ab, die sie an dem Morgen betreut hatte und auf die ich noch später in anderem Zusammenhang zu sprechen kommen werde. Wir bemerkten nunmehr, dass ungeachtet aller Traurigkeit, psychischen Erschöpfung und Schwere im Kopf die innere Anspannung, unter der wir - von kurzen Unterbrechungen abgesehen - fortlaufend gestanden hatten, nunmehr von uns gewichen war. Trotz alledem war an diesem wie auch an den darauffolgenden Tagen ein klarer Gedanke kaum möglich. Innere Entspannung und abgrundtiefe Traurigkeit wechselten ständig einander ab. Meine Frau sprach schon während der Rückfahrt vom Sozialpädiatrischen Zentrum einen wichtigen Satz aus, der auch mir nicht nur in diesem Moment, sondern auch noch später, wenn ich mich jeweils daran erinnerte, Trost spendete: „Unser Kind lebt.“ – Wie gering sind doch unsere Sorgen gegenüber dem Schmerz bzw. den Sorgen von Eltern, die ihr Kind gar (ganz) verloren haben oder die akut um dessen Leben bangen müssen.
In den ersten Tagen nach der Diagnose befanden sich Uli und ich in einem Ausnahmezustand. Wir sprachen von Anfang an offen über unseren Schmerz. Trotz ablenkender Alltagsanforderungen versuchten wir, unsere Trauer soweit wie möglich auszuleben, indem wir in entsprechenden Momenten uns der Traurigkeit hingaben. Dies verschaffte uns zwischendurch immer ein bisschen innere Entlastung, die wir brauchten, um Energie und Mut etappenweise in kleinen Portionen immer wieder neu aufzubauen. Ich selbst hatte eigentlich sehr früh das Gefühl, dass wir die mit der Behinderung unserer Tochter verbundenen Herausforderungen würden annehmen können. Trotz der Zuversicht schon in den ersten Tagen nach der Diagnose fühlten wir uns wie nach einem Schock. Morgens wachten wir beide sehr früh auf und zitterten. In diesen Augenblicken spürten wir eine Mischung aus Trauer, Unsicherheit, Angst und Alleingelassensein. Tagsüber kam man sich selbst etwas apathisch vor; ob wir damals auch so auf andere gewirkt haben, wissen wir nicht. Man empfindet nach einem solchen Verlust sich selbst ein bisschen „entrückt“, die Welt um sich herum als ein etwas „unwirklich“. Man hat den Eindruck, man werde vielleicht demnächst aufwachen und das Erlebte werde sich als Traum erweisen. Auch körperlich ist man „entrückt“. Das Körpergefühl ist herabgesetzt, die Empfindungsfähigkeit der Haut - bei Berührungen deutlich spürbar - nur noch eingeschränkt vorhanden. Ich selbst hatte damals das Gefühl, dass eine innere Stabilisierung möglich ist, wenn man sich diesem apathischen oder apathieähnlichen Zustand weitgehend hingibt. Heute bin ich überzeugt, dass wir richtig und effizient trauerten, soweit dies angesichts der äußeren Zwänge des Alltags überhaupt möglich war. Der Mensch ist vielleicht auf Betäubung - in dieser Form leichten „Entrücktseins“ - angewiesen, um in entsprechenden Situationen den Schmerz zerlegen und scheibchenweise verdauen zu können. Ohne einen solchen Mechanismus des „Entrücktseins“ könnte sehr schnell eine seelische Überforderung des Menschen bei der Verarbeitung von Trauer eintreten, die ihn „verrückt“ werden lassen könnte.
Am Tag nach der Diagnose (27. August 2005) rief u.a. auch mein Vater an. Er brachte mir gegenüber seine persönliche und emotionale Verbundenheit zum Ausdruck. Zum erstenmal in meinem Leben signalisierte er Sprach- und Ratlosigkeit. Ich freute mich über die Anteilnahme. Das galt jedoch weniger über die - von ihm gut gemeinte - Frage, ob wir einmal über die Option eines „zweiten Kindes“ nachgedacht hätten. Diese Frage wurde uns in der Folgezeit häufig auch von anderen Personen gestellt. In der ersten Zeit nach der Diagnose empfindet man solche Fragen, selbst wenn sie noch so vorsichtig und wohlwollend formuliert sind, als verletzend. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man wegen der verlustig gegangenen Vorstellung vom gesunden Kind ohnehin seelisch verletzt ist. Man empfindet die Behinderung des Kindes wie eine eigene. Man liebt sein behindertes Kind, das man sich als nicht behindert wünscht. Man möchte es aber nicht gegen ein anderes, nicht behindertes Kind austauschen. Ein solches, selbst wenn es ein eigenes ist, kann nicht als Ersatz für das behinderte Kind empfunden werden. Das Beispiel zeigt, wie wenig weiterführend konkrete Aussagen von Angehörigen und Freunden sind, wenn diese glauben, unbedingt durch bestimmte Aussagen auf eine Relativierung des Schmerzes beitragen zu müssen. Das gilt vornehmlich für die erste Zeit nach der Diagnose, in der manche betroffene Eltern aufgrund der seelischen Verletztheit geneigt sind, nahezu alles, was von anderen Menschen in Bezug auf die Behinderung des Kindes formuliert wird, negativ zu deuten.
Die beschriebene Verletzlichkeit betroffener Eltern sollte jedoch weder Angehörige noch Freunde davon abhalten, den emotionalen Beistand zu leisten, auf den erstere gerade unmittelbar nach der Diagnose angewiesen sind. Dafür ist schon ausreichend, dass in dieser Zeit Angehörige oder Freunde als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und damit betroffenen Eltern das Gefühl vermitteln, dass sie das Leid nicht alleine tragen und jederzeit auch auf praktische Unterstützung im Alltag - und sei es auch nur auf Abruf - zurückgreifen können. Das gilt insbesondere dann, wenn, wie dies in unserem Falle gewesen ist, nach der Diagnose das Förderkonzept grundlegend umgestellt bzw. intensiviert werden muss und damit ab dem genannten Zeitpunkt auch eine völlige Umorganisierung des familiären Lebensalltags ansteht. Ich erinnere mich noch heute gut daran, in welchem Ausnahmezustand sich insbesondere Uli in den ersten Wochen nach Mitteilung der Diagnose befand, mag ihr dies damals auch nicht jeder - vielleicht wegen ihrer Kämpfernatur - angemerkt haben. Später erzählte sie mir einmal, es habe mehrfach Situationen gegeben, in denen sie - während einer Autofahrt - unmittelbar dazu ansetzte, sich selbst zu versündigen. Wenn in den ersten Tagen nach der Diagnose entsprechende Hilfe ernsthaft angeboten und Anteilnahme gezeigt wird, kann dies unter Umständen allein schon ausreichend sein, um Eltern in der genannten Situation das Gefühl zu geben, dass sie nicht auf sich allein gestellt sind. Keinesfalls sollten sich nächste Angehörige des engsten Familienkreises etwa auf eine Urlaubsreise begeben, ohne vorher zu signalisieren, dass sie von einem solchen Vorhaben Abstand zu nehmen bereit sind, wenn dies die konkreten Umstände der Situation erfordern sollten. Andernfalls fühlen sich die Eltern des behinderten Kindes schlichtweg „im Stich gelassen“. Entsprechendes gilt, wenn sich Angehörige oder Freunde - gegebenenfalls aus eigener Unsicherheit, Befangenheit oder aus Angst, nicht die richtigen Worte für die Situation zu finden, - sich tage- oder gar wochenlang überhaupt nicht melden oder gar so tun, als sei nichts gewesen. Deshalb mag stilles Mitleiden oder Verharren in Befangenheit zwar als Ausdruck eigener Hilflosigkeit verständlich sein. Es überlässt jedoch betroffene Eltern letztlich sich selbst und wird von ihnen als eindeutiges Versagen des Unterstützungssystems des Freundes- bzw. Familienkreises empfunden, können sich doch Freundschaften oder familiäre Bindungen gerade nur in Krisensituationen wirklich bewähren. Besonders prekär wirkt sich ein „stilles Leiden“ von Angehörigen oder Freunden dann aus, wenn es von Handlungen begleitet wird, die sich aus der Sicht Betroffener geradezu als Verleugnung ihrer eigenen Trauer darstellen, so etwa wenn aus dem Urlaub verschickte Postkarten sich in einer Darstellung von Urlaubsfreuden erschöpfen und deshalb das Isolationsgefühl der Betroffenen noch steigern. Eine entsprechende Wirkung zeitigt ein Verhalten, das beim Trauernden den Eindruck erweckt, es werde von ihm erwartet, er müsse sofort zur Tagesordnung übergehen, weil man ja „ohnehin nichts mehr daran ändern könne“, zumal „es Schlimmeres gebe“. Als besonders rücksichtslos wird ein Verhalten empfunden, durch das ein Gesprächspartner die vom Trauernden selbst angesprochenen Aspekte übergeht, indem er dem artikulierten Leid ausschließlich oder in erster Linie Belanglosigkeiten oder gar freudige Ereignisse aus dem anderen Leben (wie etwa eine Schwangerschaft) entgegen setzt, an denen der Trauernde in seiner isolativen Situation nicht teilhaben kann. Die beschriebenen Verhaltensweisen wirken jedenfalls ignorant auf denjenigen, der nur kurze Zeit vorher die Diagnose erfahren hat, deswegen mehr oder weniger desorientiert ist und damit erst einmal von anderen Menschen dort abgeholt werden muss, wo er sich emotional befindet. Insofern unterscheidet sich die Situation nicht grundlegend von derjenigen, in der sich Angehörige beim Verlust ihnen nahestehender Menschen befinden. In diesem Zusammenhang sei angemerkt: Dritte können, wenn sie sich auf ein gesundes Taktgefühl beziehen, in der beschriebenen Situation grundsätzlich nichts falsch machen, wenn sie einfach nur signalisieren, dass sie jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und das Thema auch sie innerlich beschäftigt. Betroffene Eltern erwarten grundsätzlich nicht, dass ihnen Angehörige oder Freunde praktische Ratschläge erteilen oder für sie Problemlösungsstrategien entwickeln. In erster Linie entscheidend ist vielmehr zum Ausdruck kommende emotionale Anteilnahme: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Bereits ein Tag nach der Diagnose (am 27. August 2005) nahmen wir erstmals Kontakt zur „Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom in Deutschland e.V.“ auf. Meine Frau rief den Vorsitzenden der „Regionalgruppe Thüringen-Sachsen“ an und holte fernmündlich erste Informationen über den Verein und weitere Ansprechpartner ein. Schon drei Tage nach der Diagnose (am 29. August 2005) beantragten wir die Mitgliedschaft im Verein. Den Beitritt haben wir bis heute nicht bereut. Die persönlichen Kontakte, die wir auch über den Verein haben schließen können, haben uns bei der Trauerarbeit und der Bewältigung von durch die Behinderung unserer Tochter bedingten Konfliktlagen sehr geholfen. Diese Kontakte sind ein wesentlicher Teil eines sich nunmehr immer stärker entwickelnden Netzwerkes, das uns die erforderliche persönliche und fachliche Orientierung und Beratung auch für die Zukunft bietet.
Nach dem bei Teresa im Alter von 2 Jahren (2005) eingetretenen Entwicklungsstillstand und der schließlich ab einem Alter von ca. 2 ½ Jahren (ab Sommer 2005) eingesetzten Regression (Phase 2), in deren Zuge motorische Fähigkeiten - wie insbesondere der Handgebrauch - verloren gegangen waren, die Handstereotypien sich immer stärker herausgebildet hatten und Teresa u.a. auto- und fremdaggressive Verhaltensweisen zeigte, war - schon aus präventiven Gründen - eine Intensivierung von Therapiemaßnahmen dringend geboten. Die erforderlichen Maßnahmen der Frühförderung gehen bei Kindern mit Rett-Syndrom über reguläre heilpädagogische Konzepte hinaus. Weder an unserem damaligen Wohnort (Stadtroda) noch in deren näheren Region gab es eine Kindertageseinrichtung, die den besonderen Anforderungen an die Förderung unserer Tochter genügt hätte. Um Teresa die bestmögliche heilpädagogische Förderung zukommen zu lassen, entschlossen wir uns bald, alles daran zu setzen, ihre Aufnahme in die dafür beste (integrative) Kindertageseinrichtung in Jena zu erreichen. Hieran war uns umso mehr gelegen, als in der Einrichtung bereits ein Mädchen mit „Rett-Syndrom“ betreut wurde, das nur knapp ein halbes Jahr älter als Teresa ist. Insofern bestanden dort schon erste Erfahrungen mit der Betreuung und Förderung eines solchen - zudem gleichaltrigen - Kindes. Es handelt sich um Lilly, die Tochter der Krankenschwester (Simone), die wir bereits in der Kinderklinik des Universitätsklinikums Jena im Mai kennengelernt hatten und die nur kurze Zeit nach diesem stationären Aufenthalt - wohl im Juni/Juli (2005) - die Diagnose hinsichtlich ihrer eigenen Tochter erfahren haben dürfte. Solche Wiederbegegnungen stimmen einen stets nachdenklich. Manchmal fragt man sich in solchen Situationen, ob „Zufall“ nicht lediglich eine Fiktion ist, eine gedankliche Konstruktion, deren sich der Mensch bedient, weil er die tatsächlichen inneren Zusammenhänge zwischen Ereignissen nicht vollständig zu erfassen vermag. Jedenfalls stellte der Umstand, dass schon ein anderes Rett-Mädchen im Alter von Teresa die Einrichtung besuchte, für uns geradezu einen „Glücksfall“ dar. Denn angesichts der Seltenheit der Erkrankung (Häufigkeit: 1: 10.000 bis 1: 15.000 Mädchen) und der Vielzahl von in der Wissenschaft ungeklärten Fragen bezüglich der Erlebniswirklichkeit der betroffenen Kinder musste unbedingt gewährleistet werden, dass beide Mädchen in ein- und derselben Einrichtung betreut werden. Diese Erwägungen veranlasste die Stadt Jena, Teresa in die genannte Einrichtung aufzunehmen, obwohl dies im Hinblick auf die Zahl der bereits dort belegten Plätze an sich nicht zu vertreten gewesen wäre. Wegen der Dringlichkeit - Teresa befand sich bereits in der sogenannten Phase 2, in deren Verlauf bereits erworbene motorische Fähigkeiten (wie Greifen, Stehen etc.) wieder verlernt werden, - entsprach die Stadt Jena sehr kurzfristig dem Antrag auf Aufnahme in die Kindertagesstätte, so dass Teresa schon ab 1. November (2005) den Kindergarten besuchen konnte. Die Aufnahme in der Einrichtung und die entsprechende Bewilligung von Eingliederungshilfe setzten jedoch voraus, dass wir unseren Wohnsitz von Stadtroda nach Jena, in den Zuständigkeitsbereich des Einrichtungsträgers, verlegten. Wir mieteten ein Reihenendhaus in einem Ortsteil (Cospeda) von Jena an und zogen Ende Dezember 2005 um. Mit dem Umzug hat sich zugleich meine tägliche Fahrtstrecke zur Dienststelle auf 20 km (Jena-Weimar) verkürzt.
Dieser positive Nebeneffekt ist jedoch mehr ein „Wermutstropfen“ angesichts unserer ursprünglichen Lebensplanung, der die Diagnosemitteilung zunächst die Grundlage entzogen hat. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht verschweigen, dass wir ohne die Diagnose „Rett-Syndrom“ niemals einen Umzug nach Jena erwogen hätten. Denn wir führten bereits zum damaligen Zeitpunkt Vertragsverhandlungen mit einer Architektin über die Planung eines Einfamilienhauses in der Stadt Weimar. Schon am 25. Mai 2005 hatten wir dort ein Baugrundstück erworben. Die Vertragsverhandlungen mit der Architektin mussten wir nach der Diagnose abbrechen, weil wir das Bauvorhaben, solange Teresa die Kindertageseinrichtung in Jena besucht, zurückgestellt haben, da wir während dieser Zeit auch dort wohnen müssen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass keine der in Weimar vorhandenen Kindertages- und Fördereinrichtungen unserer Tochter eine optimale Betreuung und Förderung hätte bieten können. Das trifft auch für den dortigen Waldorf-Kindergarten zu, in den Teresa für die Zeit ab 1. September 2005 schon aufgenommen war; nach Mitteilung der Diagnose meldeten wir sie dort sofort wieder ab.
Im Anschluss an die Diagnose, die eine wesentliche Zäsur in unserem Leben bildet, war damit neben den üblichen Anstrengungen mit einem behinderten Kind der Wohnungsumzug zu organisieren, der uns nahezu die letzte Kraft raubte. Hinzu kam, dass diese Vorbereitungen zeitlich in das Anfangsstadium der Trauerphase fielen. So ganz zwischendurch leisteten wir uns Dinge, die ich aus heutiger Sicht einfach nur als Ausdruck eines „Nichtwahrhabenwollens“ deute: Da die Schulmedizin keine Therapie anbieten kann, saugten wir im Verlaufe der ersten Monate nach der Diagnose alles auf, was uns noch als Ansatz für ein letztes Stück Hoffnung dienlich erschien. Wir beschäftigten uns mit allerlei Richtungen von Alternativmedizin. Eingeschlossen war eine 14-tägige Reise zu einem Heiler (Rolf Drevermann) nach Ibiza, die wir noch im November (2005) antraten. Meine Mutter war so nett, uns bei dieser Reise zu begleiten und Teresa, die damals gerade eine sehr agressive Phase durchlebte, mitzubetreuen. Die hiermit verbundenen organisatorischen und körperlichen Anstrengungen waren für uns alle so groß, dass wir dies nicht als Erholungsurlaub empfinden konnten. Es wäre dümmlich, den Sinn solcher Unternehmungen allein am äußeren tatsächlichen Erfolg zu beurteilen. Solcherlei Aktionen sind schon hilfreich, um die erste Zeitspanne nach dem „Verlust“ zu überstehen. Sie vermitteln einem den Eindruck, der Situation nicht einfach hilflos ausgeliefert zu sein, sondern sie gestalten zu können. Sie können deshalb vorübergehend als Therapieersatz wirken und erfüllen insofern durchaus auch einen praktischen Zweck.
Eine schreckliche Zeit für uns war Weihnachten 2005. Wir saßen - alleine zu dritt - zwischen Umzugskisten. Das neue Haus reizte uns auch nicht besonders. Eine spürbare Verbesserung der Wohnsituation war aus anfänglicher Sicht mit dem bevorstehenden Umzug nicht verbunden. Dieser beruhte ausschließlich auf der Notwendigkeit, Teresa den Besuch einer optimalen Einrichtung zu ermöglichen. Hinzu kam, dass uns schon vor dem Umzug klar war, dass auch das neue Haus nur eine Übergangslösung würde sein können, weil es nicht behindertengerecht ausgestattet war. Schon im Hinblick darauf, dass sich der Wohnbereich auf über drei Etagen erstreckt, ist es für uns auf Dauer nicht geeignet. Aber etwas anderes war in der knapp bemessenen Zeit, die uns zur Verfügung gestanden hatte, eben nicht zu finden. In Anbetracht dieser Umstände waren wir noch kurz vor dem Umzug frustriert und fühlten uns insbesondere am Heiligen Abend (2005) sehr einsam und verlassen. Zudem waren wir völlig ausgebrannt. Wir hatten zwar schon alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen für den Umzug (am 28. Dezember 2005) getroffen, fragten uns aber, woher wir noch die Kraft für die letzten Vorbereitungen nehmen sollten. Wir hatten ein Umzugsunternehmen beauftragt; doch das Verpacken des Transportguts stellte nochmals eine besondere Herausforderung dar. Denn in den acht Jahren, die wir in unserer Doppelhaushälfte in Stadtroda gewohnt hatten, hatte sich eine riesige Menge an Hausrat angesammelt. Im Zustand seelischer, geistiger und körperlicher Erschöpfung empfanden wir damals alles nur noch anstrengend. Hilfe beim Umzug boten uns lediglich meine Eltern an. Auch wenn wir das Angebot zu schätzen wussten, machten wir davon keinen Gebrauch. Effektive Hilfe hätten meine Eltern im Wesentlichen nur durch Betreuung von Teresa leisten können. Dies hätte aber - zumal angesichts der damaligen schwierigen Phase von Teresa - einer aufwendigen Anleitung und Einweisung unsererseits bedurft. Wieder einmal erklärte sich unsere Nachbarin, Frau Klopfleisch, bereit einzuspringen. Sie kennt Teresa seit deren Geburt, betreute sie schon vorher häufig und ist mit deren Eigenarten bestens vertraut. Angesichts der aufgebauten Bindungen muss sie inzwischen als „stille Begleiterin“ von Teresa bezeichnet werden. Am Umzugs- und darauffolgenden Tag betreute sie Teresa in ihrem eigenen Haus. Wir sind ihr noch heute sehr dankbar dafür.
Solange Teresa den Kindergarten in Jena besucht, werden wir dort wohnen bleiben. Ich bin noch heute froh, dass ich auf den Wunsch meiner Frau, Teresa in der besagten Einrichtung anzumelden, Rücksicht genommen und dafür auch Unbequemlichkeiten - wie den zusätzlichen Umzug und den Verzicht auf die Möglichkeit, am Ort meines Arbeitsplatzes wohnen zu können - in Kauf genommen habe. Uli kennt aufgrund beruflicher Erfahrungen als Erzieherin und Heilpädagogin sehr viele Einrichtungen im Raum Jena - auch von innen -. Sie weiß, welche erheblichen qualitativen Unterschiede zwischen einzelnen Einrichtungen dort bestehen. Die integrative Kindertageseinrichtung „Kochstraße“, für die wir uns entschieden haben und in die Teresa glücklicherweise aufgenommen worden ist, nennt sich nicht nur „integrativ“. Insofern unterscheidet sie sich von vielen anderen sogenannten integrativen Kindertagesstätten, bei denen - nach meinem Eindruck - eher Imagepflege als das tatsächliche Bemühen, den Integrationsgedanken auch praktisch umzusetzen, im Vordergrund steht. Bei vielen solcher Einrichtungen ist. In der „Kochstraße“ ist das behinderte Kind nicht nur Mittel zum Zweck. Behinderte Kinder werden dort in einer Weise betreut, die woanders ihresgleichen sucht. Die Betreuungssituation insbesondere für schwerbehinderte Kinder ist beispiellos. Das Engagement geht dort so weit, dass sogar versucht wird, Krankenhauspersonal zu rekrutieren, um selbst schwerstbehinderten Kindern - wie etwa solchen, deren Atmung ständig überwacht werden muss - den Besuch des Kindergartens und damit ein Minimum an Alltagsnormalität sowohl den betroffenen Kindern als auch deren Eltern zu ermöglichen. Für schwer- und schwerstbehinderte Kinder ist grundsätzlich eine 1:1-Betreuung gewährleistet. Eine Physiotherapeutin ist in der Einrichtung fest angestellt. Jeden Tag werden in den Räumlichkeiten der Einrichtung Physiotherapie oder Logopädie angeboten. Und dann schließlich ein ganz wesentlicher Punkt: Die Betreuung und Förderung ist von Liebe getragen. Das Engagement der Angestellten geht weit über das hinaus, was man - zumal angesichts der in unserer Gesellschaft üblichen schlechten Bezahlung qualifizierten Personals - erwarten kann. Nicht zuletzt aufgrund Ulis beruflicher Erfahrungen weiß auch ich die Leistung der Erzieherinnen und Heilpädagoginnen in einer solchen Einrichtung zu schätzen.
Gerade Teresa hat mit ihrer Heilpädagogin (Uta), die sie im Kindergarten von Beginn an liebevoll betreut und außerordentlich gefördert hat, sehr viel Glück. Die Liebe, mit der sie Teresa begegnet, ist auch für uns spürbar und geradezu überwältigend. Sie ist ihr emotional so nahe, dass sie mitunter abends bei uns zuhause anruft, um sich nach dem Wohlbefinden von Teresa zu erkundigen, wenn es unserer Tochter einmal tagsüber im Kindergarten nicht so gut gegangen ist. Das, was diese Pädagogin für Teresa und damit auch für uns tut, ist unbezahlbar. Es ist gerade auch diese besondere tagtägliche Fürsorge für unsere Tochter, die uns glücklich macht und uns das Gefühl gibt, dass Teresa mit all ihren Handicaps in der Einrichtung uneingeschränkt angenommen und im echten Sinne integriert ist. Von Beginn an ist Teresa auch ersichtlich gerne in den Kindergarten gegangen. Heimweh gab es bei ihr selbst am Anfang nicht. Jeden Morgen ist sie Feuer und Flamme, wenn wir sie dorthin fahren. Als Eltern fühlen wir uns dann schon fast abgeschrieben. Sobald sie merkt, dass wir sie in den Kindergarten fahren, strahlt sie über alle Backen. Wegen ihres starken freudigen Ausdrucks gilt sie als Sonnenschein im Kindergarten. Kaum sieht sie Kinder, lacht sie sie an. Die Reaktionen der anderen Kinder fallen entsprechend aus. Sobald sie sie sehen, begrüßen sie sie euphorisch. Jedes Kind im Kindergarten, egal welcher Gruppe es dort angehört, kennt deshalb Teresa.
Sobald unsere Tochter schulpflichtig ist, sind wir nicht mehr an einen bestimmten Einrichtungsort gebunden. Denn Teresa wird voraussichtlich einmal eine spezielle Förderschule besuchen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt werden wir dann wahrscheinlich unser ursprüngliches zeitweilig auf Eis gelegtes Vorhaben - Errichtung eines Eigenheims in Weimar - wieder aufgreifen. Schon wegen der behindertengerechten Ausstattung, auf die wir ab einem bestimmten Alter von Teresa nicht mehr werden verzichten können, werden wir nicht umhin kommen, unser Wohnumfeld diesen praktischen Notwendigkeiten anzupassen. Zur Errichtung eines eigenen Hauses gibt es insofern kaum eine Alternative. Da wir das erworbene Grundstück in Weimar nicht sogleich nach der Diagnose wieder verkaufen wollten, wird dieser Ort wahrscheinlich doch unser neues Domizil werden. Letztlich aber entscheidend dafür werden in erster Linie die unterschiedlichen Optionen im Hinblick auf für Teresa geeignete Schulen sein.
Einige Wochen nach dem Umzug von Stadtroda nach Jena lief die dreijährige Elternzeit von Uli ab. Bis zur Geburt von Teresa (21. Februar 2003) hatte sie als Heilpädagogin in einer Grundschule eines privaten Trägers gearbeitet. Wegen Teresas Behinderung hat sie zunächst - bis Mitte 2008 befristeten - unbezahlten Sonderurlaub in Anspruch genommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Dinge weiter verändern werden.
Inzwischen liegt der Umzug von Stadtroda nach Jena über ein Jahr hinter uns. Nachdem wir im Verlaufe der ersten drei bis dreieinhalb Lebensjahre von Teresa sehr viel Kraft haben aufbringen müssen, um die Sorgen um unsere kleine Tochter zu bewältigen und die damit im Zusammenhang stehenden Erschwernisse des Alltags zu meistern, ist die Alltagssituation innerhalb des letzten halben Jahres deutlich entspannter geworden. Es sind nunmehr über anderthalb Jahre vergangen, seitdem uns die Diagnose „Rett-Syndrom“ mitgeteilt worden ist. Seitdem wir Klarheit haben, geht es uns deutlich besser. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt - nach einem dreiwöchigen Kuraufenthalt von Teresa und Uli und einigen Wochen Erholungsurlaub im letzten Jahr (2006) - ein Stadium erreicht haben, das man vielleicht mit spürbarer physischer und psychischer Stabilisierung zutreffend umschreiben könnte.
Weiterhin haben wir den Eindruck, dass wir den „Verlust“ inzwischen seelisch weitgehend akzeptiert haben. Vielleicht ist uns dies deshalb nicht ganz so schwer gefallen, weil wir möglicherweise von Anfang an innerlich darauf vorbereitet waren.
Ich kann nicht ausschließen, dass in unserem Unterbewusstsein die Erkenntnis, ein besonderes Kind zu haben, schon sehr früh vorhanden war. Ich erinnere mich grob an einen Traum, den ich nur wenige Monate nach Teresas Geburt hatte: Ich träumte von unserem Nachwuchs. Ein kleines Baby stand im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Dieses Baby verstarb sehr früh aus nicht nachvollziehbaren Gründen. An seiner Stelle trat dann ein anderes Baby. Es bestand für uns kein Zweifel daran, dass auch dieses andere Baby unser Kind war. Es war aber kein Neugeborenes, sondern hatte von Anfang die Größe und den Entwicklungsstand, den das erste Baby bereits erreicht hatte, als dieses verstarb.
Unmittelbar nachdem ich die Geschichte geträumt hatte, konnte ich sie noch nicht deuten. In ihm drückt sich vielleicht dieselbe Vorahnung aus, die meine Frau wohl etwa zum selben Zeitpunkt gehabt haben dürfte und von der sie mir erst später erzählt hat: Als sie einmal zusammen mit Teresa - im Kinderwagen liegend - in unserem damaligen Wohnort (Stadtroda) allein in Ruhe spazieren ging, verspürte sie plötzlich in sich eine rational nicht begründbare innere Gewissheit, deren Inhalt Uli mit folgenden Worten beschreibt, die sie damals in Gedanken gegenüber Teresa ausgesprochen haben will: „Jetzt sieht man es Dir noch nicht an, dass Du ein Handicap hast, aber Mama weiß es.“
Was unsere kleine Familie jetzt angeht:
Uli und ich sind glücklich, dass wir Teresa haben und sie genau so ist, wie sie ist. Wir können uns deshalb ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie ist ein ausgesprochen fröhliches Kind mit sehr viel Temperament. Wir glauben, sie hat sehr viel Spaß an ihrem Leben, vielleicht gerade weil sie ein „Rett-Mädchen“ ist und deshalb Zugang zu einer Erlebniswirklichkeit hat, die uns selbst letztlich immer verschlossen bleiben wird. Wir lieben sie ohne Wenn und Aber, vielleicht sogar noch ein Stück mehr, als wenn sie kein „Engelchen“ - ohne Rett-Syndrom - wäre. Teresa sich etwa ohne Rett-Syndrom vorzustellen, liefe auf eine Fiktion hinaus, weil das Rett-Syndrom Teil von Teresa ist, ihren Liebreiz prägt und sie zum „Engelchen“ macht. An gegenläufigen Wunschvorstellungen festzuhalten, wäre überdies nicht zuletzt auch Ausdruck der Unfähigkeit, einen Menschen so zu akzeptieren, wie er geschaffen worden ist – vom Lieben Gott.
Unser „Engelchen“ hat uns zu einem Perspektivenwechsel verholfen, der unser Leben bereichert hat und für den wir dankbar sind. Vieles von dem, wie wir früher manches gesehen und was wir für richtig gehalten haben, erscheint uns aus dieser neuen Perspektive eindimensional. Früher wäre für mich ein Leben mit einem behinderten Kind nicht vorstellbar gewesen. Heute ist es umgekehrt - ohne „Behinderung“ - nicht mehr vorstellbar. Ein nunmehr auch emotional fundiertes Verständnis können wir erst jetzt aufbringen für die weisen Worte des früheren Bundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker: „Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern eine Gnade...“.
Jetzt - nach nunmehr über anderthalb Jahren, nachdem uns die Diagnose „Rett-Syndrom“ mitgeteilt wurde, - schaffe ich es endlich, unsere Geschichte aufzuschreiben. Ich habe deswegen ein relativ schlechtes Gewissen, haben sich in der Zwischenzeit doch viele andere, die erst nach uns zur „Rett-Familie“ gestoßen sind, längst gemeldet und über sich und ihre Engelchen berichtet. Aber die Umstände waren in unserem Falle jedenfalls so gestrickt, dass es uns erst jetzt möglich ist, in dieser Weise zurückzublicken.
Bis zur Geburt unserer Tochter Teresa verlief unser Leben - aus jetziger Sicht - recht langweilig. Wir, Uli (inzwischen 41) und ich (inzwischen 43), waren bis dahin sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Als Erzieherin und Heilpädagogin hatte zwar Uli seit jeher ein inniges Verhältnis zu Kindern. Den eigenen Kinderwunsch - so beurteile ich dies jedenfalls aus heutiger Sicht - verdrängte sie schon deshalb über viele Jahre, weil ich mich damals stets als überzeugter „Kinderfeind“ bekannte. Nahezu in den gesamten ersten vier Jahrzehnten meines Lebens vermochte ich eine positive Vorstellung über Familie nicht zu entwickeln. Dies änderte sich erst, als mir beruflich ein letzter planbarer Aufstieg gelungen war. Ich hatte damals irgendwie das Gefühl, mir selbst nichts mehr zu schulden, mir auch selbst nicht mehr zu genügen. Diese Umstände veränderten schlagartig mein Verhältnis zu mir selbst. Es wollte vielleicht der Zufall, dass gerade zu dieser Zeit meine (jüngere) Schwester Mutter geworden war. Dieses Ereignis mag den Perspektivenwechsel zwar nicht ausgelöst, so ihn doch möglicherweise beschleunigt haben. Hinzu kam, dass meiner Frau Uli, nachdem sie kurz zuvor eine zweite Berufsausbildung erfolgreich durchlaufen hatte, klar wurde, dass jegliche Möglichkeiten beruflicher Selbstverwirklichung den in der Vergangenheit stets geleugneten Kinderwunsch nicht ersetzen konnten. Beim Einsetzen dieses Sinneswandels waren wir bereits 38 bzw. 36 Jahre alt. Als sich dann schließlich der - sehnlichst gewünschte Nachwuchs -ankündigte, waren wir beide sehr glücklich. Die Zeit der Schwangerschaft meiner Frau habe ich als die harmonischste Zeit unserer Ehe in Erinnerung. Mit Ausnahme nur punktueller Ereignisse (Ringelröteln in der Schule, in der meine Frau arbeitete, und Amniozentese) war die Schwangerschaft von keinen negativen Umständen begleitet. Dementsprechend gab es weder Komplikationen noch Auffälligkeiten im Verlauf. Nahezu keine Vorsorgeuntersuchung ließen wir aus. Bei keiner dieser Untersuchungen ergaben sich aus schulmedizinischer Sicht Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Behinderung oder Krankheit. Eine solche Möglichkeit schien sogar ausgeschlossen, nachdem auch die Amniozentese keinen auffälligen Befund ergeben hatte.
Als unsere Tochter am 21. Februar 2003 in Weimar per Kaiserschnitt zur Welt kam, stellten die behandelnden Ärzte sofort Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Atmung (Apnoen) fest, die sie diagnostisch nicht einzuordnen vermochten. Auffällig war im selben Zusammenhang, dass Teresa unmittelbar nach der Entbindung kaum schrie; auch in den darauffolgenden Stunden und Tagen gab sie selten einen Laut von sich. Vorsorglich erhielt Teresa am ersten Tag nach der Geburt eine Sauerstoffvorlage. Angesichts der stark ausgeprägten periodischen Atmung war Teresa an ein Gerät zur Kontrolle des Sättigungsgrads des aufgenommenen Sauerstoffes angeschlossen. Innerhalb der ersten Tage konnten die Ärzte zwar so gut wie gar nichts diagnostizieren, andererseits aber auch nichts - zu unserer Beruhigung - ausschließen. Wegen des Verdachts auf das Vorliegen einer ernsthaften Infektion wurde unserem Kind schon am ersten Lebenstag ein Antibiotikum verabreicht. Eine nur unzureichende Ausbildung der Lunge und das Vorliegen eines Loches im Herz konnten erst nach einigen Tagen ausgeschlossen werden. Die schon damals auffällige hypotone Muskulatur des Kindes konnten die Ärzte nicht erklären. Zur Beobachtung musste Teresa 14 Tage lang in der Neonatologie des Krankenhauses verbringen. Weil auch danach die Unregelmäßigkeiten bei der Atmung nicht eingeordnet werden und die Ärzte das Risiko eines „plötzlichen Kindstodes“ nicht ausschließen konnten, wurde Teresa in ein anderes Krankenhaus (Apolda) zur besonderen Beobachtung ihres Schlafverhaltens (Schlaflabor) überwiesen. Nachdem man sie dort 3 Tage lang beobachtet hatte, ohne dass die Ärzte eine Diagnose stellen konnten, durfte sie endlich zu uns nach Hause - wir wohnten damals noch in Stadtroda (Thüringen) -. Erst ab diesem Zeitpunkt begann für uns der normale Familienalltag. Ich hatte mir damals zwei Wochen Urlaub genommen, um die ersten Tage und Nächte zusammen mit unserem Kind richtig erleben zu können. Schon in den Krankenhäusern nahm Teresa jeden Tag geringe Mengen von - in Flüssigkeit aufgelöstem - Coffeinpulver mit den Mahlzeiten zu sich. Wir selbst setzten zuhause diese Verabreichungen auf Empfehlung der Ärzte zunächst fort. Später, als Teresa ca. 15 Monate alt war, setzten wir, zumal zwei zwischenzeitlich erfolgte Nachuntersuchungen im Schlaflabor keinen weiteren Aufschluss ergeben hatten, das Coffein langsam wieder ab.
Die Nächte waren in den ersten Lebensmonaten - so denke ich jedenfalls aus heutiger Sicht - nicht anstrengender als bei einem sogenannten gesunden Kind. Teresa machte - sowohl für uns als auch für andere - insgesamt den Eindruck eines sehr glücklichen und zufriedenen Babys. Kurz vor ihrer Geburt hatten wir einen Camcorder gekauft, mit dem wir bis heute die gesamte Entwicklung von Teresa begleitet und festgehalten haben. Währen der ersten Lebensmonate verlief diese Entwicklung - wie bei den meisten Rett-Mädchen auch - aus damaliger Sicht im Wesentlichen unauffällig. Als positiv registrierten wir, dass Teresa Gegenstände sehr ruhig und lange beobachten und sich an ihnen außerordentlich erfreuen konnte. Die Aufmerksamkeit unserer Tochter schien gut entwickelt zu sein. Das Interesse des Kindes sich fortzubewegen, schien indessen überhaupt nicht zu bestehen. Lange versuchte sie nicht einmal zu robben. Seltsam fanden wir von Anfang an, dass Teresa manchmal geradezu körperlich erstarrte. Sie wurde in diesen Augenblicken regungslos und blickte regelrecht ins Leere. Gelegentlich befürchtete meine Frau in solchen Momenten, das Kind könnte nicht mehr leben. Auffällig war weiterhin, dass Teresa bei grundsätzlich hypotoner Muskulatur in bestimmten Situationen, insbesondere beim Trinken ihrer Milch aus der Flasche, sich so sehr verkrampfte, dass sie richtig steif wurde.
Jedenfalls ungefähr ab dem 9. Lebensmonat entwickelte sich Teresa in motorischer Hinsicht langsamer als andere Kinder. Etwa mit 8 Monaten drehte sie sich aus der Rücken- in die Bauchlage und umgekehrt. Das freie Sitzen erlernte sie ungefähr im Alter von 8 bis 10 Monaten. Während wir das auf die Geburt von Teresa folgende erste Weihnachtsfest (2003) noch unbeschwert von Sorgen erleben durften, waren wir zum Zeitpunkt ihres ersten Geburtstags (am 21. Februar 2004) etwas bedrückt, mussten wir doch feststellen, dass Teresa nicht einmal Ansätze zum Krabbeln zeigte, sondern, wenn sie auf dem Bauch lag, sich in die Richtung, in die sie schauen wollte, lediglich mit ihren Händen drehen konnte. Sie war lediglich in der Lage, sich - auf dem Bauch liegend - um einen bestimmten Punkt herum zu drehen. Der Umstand, dass sie zu diesem Zeitpunkt gelegentlich mehrsilbige Wörter aussprach, konnte uns die Verunsicherung nicht nehmen. Erst im Alter von ca. 15 Monaten konnte sie richtig robben. Von Krabbeln im eigentlichen Sinne war auch zu diesem Zeitpunkt nichts erkennbar. Allerdings konnte sie damals die Wörter „Mama“, „Papa“ und „da“ aussprechen und erfasste ebenso den Bedeutungsinhalt dieser Begriffe. Wenn ich ihr ein Bild zeigte, auf dem außer mir andere Personen zu sehen waren, sagte sie, wenn ich den Finger unkommentiert auf mich selbst richtete, spontan „Papa“. Wenn sie ihrerseits auf einen Gegenstand zeigte, dem ihr Interesse galt, sagte sie „da“.
Als Teresa ca. 16 Monate alt war, wandten wir uns wegen ihrer motorischen Beeinträchtigungen vorsorglich an einen Orthopäden (in Weimar). Wir hielten es wegen eines früheren Hüftleidens meiner Frau Uli in deren ersten zwei Lebensjahren nicht für ausgeschlossen, dass die Ursache für die nach unserer Einschätzung nur schwach entwickelte Mobilität von Teresa in einem „ererbten“ Hüftschaden lag. Der aufgesuchte Arzt zerstreute diese Bedenken anhand einer Röntgenaufnahme. Bedauerlicherweise konnte er sich die Bemerkung, wir sollten uns an einen Neurologen wenden, zumal - angesichts der Physiognomie des Kindes - ein Down-Syndrom vorliegen müsse, nicht verkneifen. Er sagte wörtlich: „Natürlich ist dafür ein Neurologe zuständig. Dies ist ein Down-Syndrom. Das sieht man doch.“ Diese von wenig Einfühlsamkeit zeugende Formulierung schockierte und verärgerte uns beide gleichermaßen. Es war das erste Mal, dass wir mit einem solchen Verdacht konfrontiert waren. Er lag für uns schon deshalb fern, weil die Fruchtwasseruntersuchung keinen auffälligen Befund ergeben hatte.
Ein zweites Mal wurden wir ärztlicherseits mit einem entsprechenden Verdacht konfrontiert, als Teresa ca. 18 Monate alt war. Es war gerade Hochsommer; während eines Ausfluges nach Jena an einem Sonntagnachmittag wurde Teresa von einer Wespe gestochen und schrie fürchterlich. Da dies „glücklicherweise“ in räumlicher Nähe zur Kinderklinik des Universitätsklinikums passierte, fuhren wir sie auf dem schnellsten Wege dorthin. Der zu diesem Zeitpunkt als einziger anwesende Assistenzarzt stellte mehrere Fragen zu Vorerkrankungen und zum bisherigen Entwicklungsverlauf. Er wunderte sich darüber, dass Teresa noch nicht laufen konnte. Er erklärte, dass nach seiner Auffassung ein Down-Syndrom (in Mosaik-Form) - ungeachtet der Ergebnisse der vorgeburtlichen Untersuchungen - nicht auszuschließen sei. Die Art, in der er sein diesbezügliches Interesse zum Ausdruck brachte, zeugte ebenfalls von wenig Einfühlungsvermögen. Eine gewisse Faszination über den „Fall“ war ihm ersichtlich anzumerken. Geradezu mit wissenschaftlichem Enthusiasmus warb er dafür, unsere Tochter in der Kinderklinik insbesondere neurologisch untersuchen zu lassen; in diesem Falle würde man sicherlich „etwas bei ihr finden“. Sein menschlich unreifes Verhalten - man hatte den Eindruck, man habe einen Medizinstudenten im ersten Semester vor sich, der aus eigener Profilierungssucht alle denkbaren Schreckensbilder aufzeigen wollte - entsetzte uns. Ich selbst fand dieses Auftreten angesichts der emotionalen Betroffenheit von Eltern derart unangemessen, dass ich ihn darauf hinwies. Er zeigte sich daraufhin irritiert und verstummte fast.
Etwas später - etwa im Alter von 18-20 Monaten - fing Teresa zu unserer Freude an zu krabbeln. Der Bewegungsablauf wurde dabei allmählich sicherer und schneller. Mit ca. 20 Monaten schaffte sie es immerhin, vom Fußboden aus auf ein ca. 40 cm hohes Trampolin zu krabbeln. Ihre Sprache entwickelte sich indessen nicht weiter. Zu beobachten war, dass sie - häufig vor dem Spiegel - Selbstgespräche in einer dem Anschein nach eigenen Sprache zu führen schien. Der aktive Sprachschatz erweiterte sich nicht. Auffällig war, dass sie ungefähr ab dem 20. Lebensmonat die Wörter „Mama“ und „Papa“ immer seltener aussprach. Im Alter von ca. 2 Jahren gelang es ihr, sich in ihrem Bettchen aus dem Sitzen in den Stand hochzuziehen. Entsprechendes war ihr an einem kleinen Tisch möglich, an dem sie sich anschließend auch festhalten konnte. Häufig saß sie damals auch auf einem kleinen Stühlchen an diesem Tisch und malte mit bunten Stiften auf Papier. Aufgrund der bis dahin stetigen, wenn auch verzögerten motorischen Entwicklung waren wir trotz schon damals vorhandener Sorgen doch immer noch zuversichtlich. Der Gedanke an eine gravierende Behinderung lag jedenfalls noch fern. Im Hinblick auf die erwähnten unbedachten Äußerungen bestimmter Ärzte dachten wir lediglich an die Möglichkeit einer abgeschwächten Ausprägung des Down-Syndroms, hielten aber auch dies schon in Ansehung der Physiognomie unserer Tochter und der übrigen fehlenden typischen körperlichen Merkmale für unwahrscheinlich.
Ungefähr ab Vollendung ihres 2. Lebensjahres stagnierte die motorische Entwicklung. Die aktiven sprachlichen Fähigkeiten, die sich bis dahin auf nur ganz wenige Wörter bezogen hatten, bildeten sich sogar zurück. Etwa im Alter von 26 Monaten begann Teresa, - für uns zunächst nicht einzuordnende - Handstereotypien („Zupfen“) und immer stärker autistisch wirkende Verhaltensmuster zu entwickeln. Ab diesem Zeitpunkt krabbelte sie auch weniger. Die Handstereotypien prägten sich immer stärker aus. Angesichts der bei Teresa eingetretenen Entwicklungsstagnation und des immer größer gewordenen Abstandes zum Entwicklungsniveau anderer Kinder ihres Alters fingen meine Frau und ich an, ernsthaft darüber nachzudenken, ob dem atypischen Entwicklungsverlauf nicht doch eine bestimmte Behinderung unserer Tochter zugrunde liegen könnte. Alle bis dahin unternommenen Versuche, das Entwicklungsdefizit mit den Methoden von Ostheopathie, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Bioresonanztherapie auch nur ansatzweise auszugleichen, stellten sich jetzt als nicht mehr erfolgversprechend dar. Wir entschlossen uns deshalb, Teresa zunächst grundlegend schulmedizinisch, insbesondere neurologisch, untersuchen zu lassen. Getragen war dieser Entschluss vor allem von unserem Wunsch, frühzeitig und nicht erst in einigen Jahren die Ursache für den bis dahin nicht erklärlichen Entwicklungsverlauf von Teresa zu erfahren. Dahinter stand nicht nur unser Anliegen, gegebenenfalls rechtzeitig die jeweils geeignete Therapie einleiten zu können. Wir gingen auch davon aus, dass wir uns um so schneller auf eine etwaige Behinderung einstellen, damit abfinden und gegebenenfalls Energieverluste vermeiden können, je früher die Krankheit diagnostiziert werden würde. Mit Energieverlusten hatten wir bereits über einen längeren Zeitraum Erfahrungen gemacht. Nicht nur die Vielzahl der bereits erwähnten Therapiemaßnahmen, die Teresa von Geburt an durchlaufen hatte und die Uli als Begleit- und Betreuungsperson immer stärker auch körperlich beansprucht hatten, begannen, Spuren der Erschöpfung zu hinterlassen. Der Wechsel zwischen immer wieder neu geschöpfter Hoffnung und wiederholten Frustrationen - etwa wenn wir sahen, wie sich andere gleichaltrige Kinder bewegten - entfaltete eine immer stärker werdende Demoralisierungswirkung und vertiefte sukzessive unseren Schmerz.
Zunächst stellten wir Teresa (am 22. April 2005) einer noch jungen Kinderärztin im Sozialpädiatrischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena vor. Diese empfahl uns eine mehrtägige stationäre Untersuchung in der neuropädiatrischen Abteilung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Nach anfänglichen Bedenken entschieden wir uns für einen stationären Aufenthalt. Da ein Teil der Untersuchungen auf unser Drängen hin ambulant (am 16. und 17. Mai 2005) durchgeführt wurden, dauerte der anschließende stationäre Aufenthalt drei Tage (vom 18. bis 21. Mai 2005). Teresa durchlief dabei das neuropädiatrische Standardprogramm sowie weitere Untersuchungen (auf bestimmte Stoffwechselstörungen).
An einem der Abende während des stationären Aufenthaltes betrat eine noch junge Krankenschwester (Simone) das Zimmer, in dem Teresa zusammen mit Uli - als Begleitperson - untergebracht war. Ich weiß inzwischen nicht mehr, ob wir damals Wote miteinander wechselten; wahrscheinlich war dies nicht der Fall. Ich weiß heute nur noch, dass ich - erschöpft von den Anspannungen des Tages - auf einem Stuhl saß und mir beim Anblick der jungen, frisch wirkenden Frau spontan ein seltsamer Gedanke durch den Kopf schoss: „Vielleicht waren wir einfach zu alt, um ein gesundes Kind zu bekommen. Diese Frau ist zu beneiden. Sie wird Probleme, wie wir sie haben, nicht kennen.“ Wie falsch man gelegentlich liegt! Als ich am darauffolgenden Samstagmorgen nach Abschluss der Untersuchungen Teresa und Uli aus der Klinik abholte und nach Hause fuhr, erzählte Uli, sie habe sich sehr nett mit der besagten Krankenschwester unterhalten. Diese sei von Teresa entzückt gewesen und habe, als sie gesehen habe, wie Teresa in ihrem Bettchen herumgeturnt und sich am Bettgitter hochgezogen habe, gesagt: „Ihre Tochter ist ja richtig fit. So etwas kann meine kleine Lilly nicht.“ Auf Frage meiner Frau, was ihrer - etwa gleichaltrigen - Tochter denn fehle, habe sie geantwortet, sie wisse dies nicht, ihre Tochter sei jedenfalls behindert. Als ich dies hörte, plagte mich wegen meiner Gedanken vom Vortag ein schlechtes Gewissen.
Ungefähr im Sommer 2005 ging das aktive Sprachvermögen im engeren Sinne vollends verloren; Teresa sprach fast kein einziges Wort mehr. Nach Durchführung der Untersuchungen, noch vor Auswertung der Ergebnisse, verbrachten wir gemeinsam zu dritt einen Urlaub in Dänemark, um nervlich etwas zu entspannen. In dieser Zeit fing ich an, immer stärker daran zu glauben, dass die Entwicklungsbeeinträchtigung von Teresa eine neurologische Ursache haben müsse; mir fiel auf, dass ihre Zunge sehr stark zitterte, wenn sie beim Essen den Mund öffnete.
Die Ergebnisse der im Universitätsklinikum Jena durchgeführten Untersuchungen wurden uns erst ca. anderthalb Monate später - in einem Gespräch mit dem Direktor der Neuropädiatrischen Abteilung und des Sozialpädiatrischen Zentrums (Prof. Dr. Ulrich Brandl) sowie mit Frau Dr. Küchler, einer auf humangenetische Fragen spezialisierten Ärztin, (am 5. Juli 2005) - mitgeteilt. Hiernach war insbesondere eine therapierbare Stoffwechselerkrankung im herkömmlichen Sinne auszuschließen. Als pathologisch auffällig bezeichneten die Ärzte indessen den Befund eines bereits im Mai durchgeführten Mittagsschlaf-EEG. Sie äußerten die Auffassung, dass diese Ergebnisse auf ein noch nicht bestimmbares Krankheitsbild mit möglichen Anfallsleiden hinweisen könnten; bei einer Gesamtbetrachtung aller Auffälligkeiten sei bei Teresa am ehesten noch von einer autistischen Störung auszugehen. Als Therapiemaßnahmen empfahlen sie vorerst nur die Fortführung von Physiotherapie und die Anwendung von Logopädie. Zugleich sollte die Entwicklung von Teresa aufmerksam weiter verfolgt werden. Vor den Schlussbemerkungen verständigte sich Prof. Dr. Brandl mit seiner Kollegin in gewollt unauffälliger Form durch bestimmte Andeutungen darüber, ob er einen bis dahin nicht ausgeräumten Verdacht uns gegenüber erwähnen sollte. Sie signalisierte ihm, dass sie die Erörterung - wohl angesichts der Verhaltensmuster von Teresa, die bei diesem Gespräch anwesend war und bereits charakteristische Handstereotypien zeigte - für geboten hielt. Er sprach das Thema „Rett-Syndrom“ an, von dem wir beide bis dahin noch nie gehört hatten, und beschrieb das Krankheitsbild zwar knapp und korrekt, aber in einer Weise, die den möglichen Schweregrad der Behinderung bei weitem nicht erahnen ließ. Er gab sich - aus heutiger Sicht - also sehr viel Mühe, uns das Thema langsam und schonend nahe zu bringen. Zudem stellte er die Verdachtsdiagnose „Rett-Syndrom“ als - gegenüber einer autistischen Störung - weniger wahrscheinlich dar. Weiteren Aufschluss könne insoweit nur eine molekulargenetische Untersuchung bringen, für die es einer gesonderten Einwilligung und einer entsprechenden Kostenübernahmeerklärung unsererseits bedürfe. Da wir auch insoweit Klarheit erreichen wollten, willigten wir sofort ein. Nach Beendigung dieses Gesprächs fühlten wir uns zunächst erleichtert, weil uns die Auswirkungen des Rett-Syndroms im einzelnen nicht bekannt waren, zumal sich die Ärzte - wohl bewusst - auf nur vage Angaben beschränkt hatten. Hinzu kam, dass meine Frau und ich, als wir im Rahmen des genannten Gesprächs zum ersten Mal vom Rett-Syndrom hörten, zunächst lediglich an das im häufiger bekannte „Tourette-Syndrom“ dachten, eine deutlich weniger gravierende Diagnose, die wir angesichts der Verhaltensmuster unserer Tochter auch ohnehin nur für theoretisch möglich hielten.
Wir fühlten uns in den darauffolgenden Tagen beide so leicht (im Kopf) wie lange nicht mehr - ein Gefühl, das wir aufgrund der ständigen Sorgen bereits seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr erlebt hatten und das uns deshalb inzwischen nahezu fremd geworden war -. Dieser Zustand sollte jedoch nicht sehr lange andauern. Nur etwa zwei Tage nach diesem Gespräch registrierte ich, dass sich die positive Stimmung meiner Frau etwas gedämpft hatte. Diese Verstimmung war aus meiner Sicht jedoch nicht so stark, dass für mich Veranlassung bestand, Uli darauf anzusprechen. Zwei weitere Tage später (am 9. Juli 2005, einem Samstag) warf ich einen Blick in das Klinische Wörterbuch „Pschyrembel“ (258. Auflage 1998) und las unter dem Stichwort „Rett-Syndrom“. Was dort geschrieben stand, ging erheblich über die entsprechenden Andeutungen der Ärzte hinaus und beunruhigte mich ein bisschen, zumal Teresa schon zur damaligen Zeit einen Teil der beschriebenen Symptome zeigte. Noch am selben Tag sprach ich Uli auf das Thema an und fragte sie, ob sie Näheres über das Rett-Syndrom wisse. Uli erzählte mir daraufhin, dass sie zwischenzeitlich im Internet recherchiert habe; das, was sie dort über das Krankheitsbild gelesen habe, habe sie deprimiert, weil ein beträchtlicher Teil der beschriebenen Symptome bei Teresa zutreffe. Diese Antwort steigerte meine innere Unruhe und veranlasste mich sofort, ebenfalls im Internet zu recherchieren. Ich wurde dort sehr schnell fündig. Auf welcher Internet-Seite ich damals was im Einzelnen gelesen habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Die Informationen waren jedenfalls eindeutig in Bezug auf die Schwere des Krankheitsbildes. Ich fühlte mich in diesem Moment von innerem Entsetzen überwältigt, zumal ich aufgrund der Ausführungen zur Symptomatik es jetzt als nicht mehr fernliegend einschätzte, dass bei Teresa dieses Krankheitsbild diagnostiziert werden könnte. Als ich Erlebnisberichte betroffener Eltern las, traten mir Tränen in die Augen. Ich war innerlich so niedergeschlagen wie lange nicht mehr. Ich fragte meine Frau, weshalb sie, nachdem sie als erste die Ausführungen gelesen hatte, mich nicht ihrerseits sofort auf das Thema angesprochen habe. Sie antwortete, sie habe mich nicht beunruhigen wollen. Im Verlaufe der darauffolgenden Wochen waren wir gedanklich ständig bei der noch ausstehenden Diagnose, zumal uns diese schon in wenigen Wochen eröffnet werden sollte. Trotzdem hatte ich während dieser Zeit überwiegend das Gefühl, dass das Rett-Syndrom bei unserer Tochter nicht diagnostiziert werden würde; bislang hatten wir trotz mancher Unbequemlichkeiten in unserem Leben letzten Endes immer wieder Glück gehabt und waren von Schicksalsschlägen stets verschont geblieben. Schon deshalb konnte man sich damals noch nicht richtig vorstellen, dass es einen selbst diesmal „wirklich hart“ treffen könnte. Andererseits war ein Fortschritt in der motorischen Entwicklung von Teresa nun seit längerer Zeit nicht mehr zu beobachten. Vielmehr hatten wir den Eindruck, dass sich ihre Motorik sogar zurückentwickelte; dies galt namentlich für den willensgesteuerten Einsatz ihrer Hände. Das nicht endende Wechselbad von Hoffen, Bangen und Verarbeitung von Frustrationen ging in dieser Zeit bei uns beiden immer stärker an die Substanz. Zu meiner eigenen Frustration trug schließlich die Einschätzung bei, dass selbst dann, wenn das Rett-Syndrom bei Teresa nicht diagnostiziert werden würde, eine andere - möglicherweise nicht weniger gravierende - Behinderung vorläge, für die es noch keine Bezeichnung gäbe. Gewissheit über die Auswirkungen einer namenlosen Krankheit erst irgendwann einmal - nach weiteren Kräfte zehrenden Jahren - zu erlangen, stellte sich als nicht wesentlich bessere Alternative dar.
Am Mittwoch, dem 24. August 2005, rief mich Frau Dr. Küchler auf der Dienststelle an und teilte mir endlich mit, dass die Ergebnisse der molegulargenetischen Untersuchung vorlägen. Sie stellte mir zwei Besprechnungstermine zur Auswahl: Freitag, 26. August oder Montag, 29. August. Ich entschied mich für den früheren Termin. Die Nervosität wurde auf unserer Seite jetzt immer größer. Dem Umstand, dass die Ärztin davon abgesehen hatte, mir bereits am Telefon eine Information zukommen zu lassen, maß ich keine Bedeutung bei. Uns war bereits von den ersten Untersuchungen her bekannt, dass entsprechende Untersuchungsergebnisse - unabhängig vom (positiven oder negativen) Inhalt - grundsätzlich nicht fernmündlich übermittelt werden. Trotzdem waren leichte Zweifel bei mir entstanden, ob das Absehen von einer beruhigenden Andeutung der Ärztin nicht doch als schlechtes Zeichen gewertet werden musste. Bei dem vereinbarten Termin (am Morgen des 26. August im Sozialpädiatrischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena) war Teresa nicht anwesend. Das Gespräch führten wieder Prof. Dr. Brandl und Frau Dr. Küchler. Wir wurden im Wartezimmer von beiden persönlich abgeholt und in einen Besprechungsraum geführt. Kurz nachdem wir Platz genommen hatten, kam Prof. Dr. Brandl - entgegen seiner für ihn sonst typischen langatmigen Ausführungen - sehr schnell auf den Punkt, so schnell, dass ich mir innerlich fast „überrannt“ vorkam. Soweit ich mich jetzt noch erinnere, verzichtete er auf jegliche einleitenden Worte. Er sagte ungefähr wörtlich: „Also es hat sich doch bestätigt“. Bei mir bestand in diesem Moment völlige Unklarheit in allen Richtungen - bei meiner Frau dürfte es ebenso gewesen sein -. Die weiteren Ausführungen von Prof. Dr. Brandl zur festgestellten Mutation erhellten sehr schnell den Inhalt seiner These: die jeden Zweifel ausschließende Bestätigung der Diagnose „Rett-Syndrom“. Ich hatte den Eindruck, dass meine Frau erst in dem Moment, in dem der Arzt den Begriff „Rett-Syndrom“ aussprach, wirklich den Inhalt des uns mitgeteilten Untersuchungsergebnisses erfasste, verstehen wollte, konnte, musste. Ab diesem Moment konnten wir beide den Ausführungen des Arztes kaum noch folgen. Ich überlegte deshalb, ob ich um eine Gesprächspause bitten sollte, denn ich hatte das Gefühl, dass ich zunächst nach Luft schnappen und mir erst einmal den Schmerz aus der Seele herausbrüllen müsste. Meiner Frau ging es ähnlich. Unter Hinweis auf meine nur noch beschränkt vorhanden gewesene Aufnahmefähigkeit bat ich darum, das Gespräch auf das unbedingt Notwendige zu beschränken und Einzelheiten einer späteren Unterredung vorzubehalten. Dementsprechend stellten wir nur noch wenige Fragen. Prof. Dr. Brandl fiel es ersichtlich schwer, uns die Diagnose mitzuteilen; schon an dieser Stelle sei angemerkt, dass die persönliche Anteilnahme ihm sogar später noch - ca. ein Jahr nach der Diagnose - bei einer erneuten Besprechung (am 5. September 2006) anzumerken war. Es mag eigenartig klingen, aber ich dachte, als Prof. Dr. Brandl uns das Ergebnis der molekulargenetischen Untersuchung mitgeteilt hatte, daran, wie unangenehm es für ihn selbst sein müsse, uns dies alles zu erklären. Seine Situation erinnerte mich sehr stark an diejenige, in der ich mich nicht selten befand, wenn ich von Berufs wegen einem Asylbewerber verdeutlichen musste, dass er nach einem über viele Jahre dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet in sein Herkunftsland, zu dem er keinerlei Bindungen mehr hatte, werde zurückzukehren müssen. Die Einlassungen von Herrn Prof. Dr. Brandl signalisierten echte gefühlsmäßige, nicht nur gespielte Anteilnahme. Eine solche war bei der Assistenzärztin weniger festzustellen. Sie konfrontierte uns noch im Verlaufe des Gesprächs mit - selbst nach Auffassung des Professors völlig überflüssigen - Erklärungsvordrucken, die wir - im Hinblick auf die privatärztliche Behandlung unserer Tochter - schnell noch unterschreiben sollten, um eine Abrechnung über eine externe Verrechnungsstelle zu ermöglichen. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr nur darum ging, überobligatorisches Engagement gegenüber dem Professor zu demonstrieren und sich dadurch zu profilieren. Dieser Profilierungsversuch schlug indessen gründlich fehl. Denn der Professor reagierte schon in unserer Gegenwart außerordentlich ungehalten auf das streberhaft anmutende Verhalten seiner Kollegin. In unserem Beisein kritisierte er sie und forderte sie auf, uns „jetzt nicht in dieser Situation mit solchem bürokratischen Mist zu belästigen“.
Als wir endlich das Gebäude des Sozialpädiatrischen Zentrums verlassen hatten, nahmen wir uns - noch vor der Eingangstür - gegenseitig in die Arme und klammerten uns aneinander krampfhaft fest, um uns gegenseitig zu stützen. Der Schmerz, den man in solch einem Augenblick in sich spürt, ist unbeschreiblich. Wenn die Vorstellung, ein gesundes Kind zu haben, durch eine entsprechende Diagnose endgültig zerstört wird, stirbt einem ein Teil dieses Kindes weg. Auch wenn einen die Eröffnung einer solchen Diagnose nicht völlig unvorbereitet trifft, weil man sie schon vorher für möglich gehalten und sich gedanklich damit auseinander gesetzt hat, bedeutet sie doch, dass sie in diesem Moment als unwiederbringlicher, endgültiger Verlust einer Beziehung empfunden wird. Diffuse Schuldgefühle gingen mir durch den Kopf. Die bloße rationale Erkenntnis, dass man sich selbst nichts - rein gar nichts - insoweit vorzuwerfen hat, ist in der Situation nicht weiter führend. Sie ändert nichts an dem vagen Eindruck, für die Behinderung des eigenen Kindes - und sei es auch nur im Sinne einer „conditio sine qua non“ - verantwortlich zu sein. Vielleicht entspringt dieses - rational nicht begründbare - Gefühl einem Bedürfnis des Menschen, eine Erklärung dafür zu finden, weshalb ausgerechnet das eigene Kind dasjenige unter 10.000 oder 15.000 Mädchen sein soll, das vom Rett-Syndrom betroffen ist. Obwohl man schon vorher allmählich immer „bösgläubiger“ geworden ist und deshalb mit der Diagnose gerechnet hat, tut man sich sehr schwer, es dann, wenn endgültige Gewissheit eintritt, auch zu glauben und als gegeben hinzunehmen. Man hat in dieser Situation das Gefühl, dass Verstand und Gefühl nicht mehr zueinander passen, sozusagen auseinander driften. Was tut man in einer solchen Situation? Die Menschen sind so unterschiedlich, dass alle unterschiedlich reagieren, und auch unterschiedlich reagieren müssen, schon um die ersten Minuten nach dem Verlust zu überstehen. Es wäre deshalb verfehlt, aus einer „ex-post“-Betrachtung der eigenen Betroffenheit heraus für andere vorbeugend Verhaltensempfehlungen oder Handlungsstrategien für diese ersten Minuten entwickeln zu wollen. Was machten wir in der Situation ? Wir setzten uns ins Auto und fuhren ohne Ziel planlos durch die Gegend. Während der Fahrt überlegten wir nur: „Wohin sollen wir fahren? Jetzt einfach nach Hause fahren wollen wir jedenfalls nicht.“ Unterwegs rief Uli per Handy Mutter und Schwiegermutter an und informierte sie beide über die Diagnose. An einer Autobahnraststätte hielten wir an. Ich glaube, es war das erste und bislang einzige Mal in meinem Leben, dass ich an einem Werktagmorgen - noch dazu auf nüchternen Magen - eine Flasche Bier trank. Der Zustand der Betäubung, in den ich dadurch sehr schnell flüchten konnte, verschaffte mir die in diesem Moment dringend benötigte seelische Verschnaufpause. Zuhause angekommen holten wir zunächst Teresa bei unserer Nachbarin (Frau Klopfleisch) ab, die sie an dem Morgen betreut hatte und auf die ich noch später in anderem Zusammenhang zu sprechen kommen werde. Wir bemerkten nunmehr, dass ungeachtet aller Traurigkeit, psychischen Erschöpfung und Schwere im Kopf die innere Anspannung, unter der wir - von kurzen Unterbrechungen abgesehen - fortlaufend gestanden hatten, nunmehr von uns gewichen war. Trotz alledem war an diesem wie auch an den darauffolgenden Tagen ein klarer Gedanke kaum möglich. Innere Entspannung und abgrundtiefe Traurigkeit wechselten ständig einander ab. Meine Frau sprach schon während der Rückfahrt vom Sozialpädiatrischen Zentrum einen wichtigen Satz aus, der auch mir nicht nur in diesem Moment, sondern auch noch später, wenn ich mich jeweils daran erinnerte, Trost spendete: „Unser Kind lebt.“ – Wie gering sind doch unsere Sorgen gegenüber dem Schmerz bzw. den Sorgen von Eltern, die ihr Kind gar (ganz) verloren haben oder die akut um dessen Leben bangen müssen.
In den ersten Tagen nach der Diagnose befanden sich Uli und ich in einem Ausnahmezustand. Wir sprachen von Anfang an offen über unseren Schmerz. Trotz ablenkender Alltagsanforderungen versuchten wir, unsere Trauer soweit wie möglich auszuleben, indem wir in entsprechenden Momenten uns der Traurigkeit hingaben. Dies verschaffte uns zwischendurch immer ein bisschen innere Entlastung, die wir brauchten, um Energie und Mut etappenweise in kleinen Portionen immer wieder neu aufzubauen. Ich selbst hatte eigentlich sehr früh das Gefühl, dass wir die mit der Behinderung unserer Tochter verbundenen Herausforderungen würden annehmen können. Trotz der Zuversicht schon in den ersten Tagen nach der Diagnose fühlten wir uns wie nach einem Schock. Morgens wachten wir beide sehr früh auf und zitterten. In diesen Augenblicken spürten wir eine Mischung aus Trauer, Unsicherheit, Angst und Alleingelassensein. Tagsüber kam man sich selbst etwas apathisch vor; ob wir damals auch so auf andere gewirkt haben, wissen wir nicht. Man empfindet nach einem solchen Verlust sich selbst ein bisschen „entrückt“, die Welt um sich herum als ein etwas „unwirklich“. Man hat den Eindruck, man werde vielleicht demnächst aufwachen und das Erlebte werde sich als Traum erweisen. Auch körperlich ist man „entrückt“. Das Körpergefühl ist herabgesetzt, die Empfindungsfähigkeit der Haut - bei Berührungen deutlich spürbar - nur noch eingeschränkt vorhanden. Ich selbst hatte damals das Gefühl, dass eine innere Stabilisierung möglich ist, wenn man sich diesem apathischen oder apathieähnlichen Zustand weitgehend hingibt. Heute bin ich überzeugt, dass wir richtig und effizient trauerten, soweit dies angesichts der äußeren Zwänge des Alltags überhaupt möglich war. Der Mensch ist vielleicht auf Betäubung - in dieser Form leichten „Entrücktseins“ - angewiesen, um in entsprechenden Situationen den Schmerz zerlegen und scheibchenweise verdauen zu können. Ohne einen solchen Mechanismus des „Entrücktseins“ könnte sehr schnell eine seelische Überforderung des Menschen bei der Verarbeitung von Trauer eintreten, die ihn „verrückt“ werden lassen könnte.
Am Tag nach der Diagnose (27. August 2005) rief u.a. auch mein Vater an. Er brachte mir gegenüber seine persönliche und emotionale Verbundenheit zum Ausdruck. Zum erstenmal in meinem Leben signalisierte er Sprach- und Ratlosigkeit. Ich freute mich über die Anteilnahme. Das galt jedoch weniger über die - von ihm gut gemeinte - Frage, ob wir einmal über die Option eines „zweiten Kindes“ nachgedacht hätten. Diese Frage wurde uns in der Folgezeit häufig auch von anderen Personen gestellt. In der ersten Zeit nach der Diagnose empfindet man solche Fragen, selbst wenn sie noch so vorsichtig und wohlwollend formuliert sind, als verletzend. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man wegen der verlustig gegangenen Vorstellung vom gesunden Kind ohnehin seelisch verletzt ist. Man empfindet die Behinderung des Kindes wie eine eigene. Man liebt sein behindertes Kind, das man sich als nicht behindert wünscht. Man möchte es aber nicht gegen ein anderes, nicht behindertes Kind austauschen. Ein solches, selbst wenn es ein eigenes ist, kann nicht als Ersatz für das behinderte Kind empfunden werden. Das Beispiel zeigt, wie wenig weiterführend konkrete Aussagen von Angehörigen und Freunden sind, wenn diese glauben, unbedingt durch bestimmte Aussagen auf eine Relativierung des Schmerzes beitragen zu müssen. Das gilt vornehmlich für die erste Zeit nach der Diagnose, in der manche betroffene Eltern aufgrund der seelischen Verletztheit geneigt sind, nahezu alles, was von anderen Menschen in Bezug auf die Behinderung des Kindes formuliert wird, negativ zu deuten.
Die beschriebene Verletzlichkeit betroffener Eltern sollte jedoch weder Angehörige noch Freunde davon abhalten, den emotionalen Beistand zu leisten, auf den erstere gerade unmittelbar nach der Diagnose angewiesen sind. Dafür ist schon ausreichend, dass in dieser Zeit Angehörige oder Freunde als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und damit betroffenen Eltern das Gefühl vermitteln, dass sie das Leid nicht alleine tragen und jederzeit auch auf praktische Unterstützung im Alltag - und sei es auch nur auf Abruf - zurückgreifen können. Das gilt insbesondere dann, wenn, wie dies in unserem Falle gewesen ist, nach der Diagnose das Förderkonzept grundlegend umgestellt bzw. intensiviert werden muss und damit ab dem genannten Zeitpunkt auch eine völlige Umorganisierung des familiären Lebensalltags ansteht. Ich erinnere mich noch heute gut daran, in welchem Ausnahmezustand sich insbesondere Uli in den ersten Wochen nach Mitteilung der Diagnose befand, mag ihr dies damals auch nicht jeder - vielleicht wegen ihrer Kämpfernatur - angemerkt haben. Später erzählte sie mir einmal, es habe mehrfach Situationen gegeben, in denen sie - während einer Autofahrt - unmittelbar dazu ansetzte, sich selbst zu versündigen. Wenn in den ersten Tagen nach der Diagnose entsprechende Hilfe ernsthaft angeboten und Anteilnahme gezeigt wird, kann dies unter Umständen allein schon ausreichend sein, um Eltern in der genannten Situation das Gefühl zu geben, dass sie nicht auf sich allein gestellt sind. Keinesfalls sollten sich nächste Angehörige des engsten Familienkreises etwa auf eine Urlaubsreise begeben, ohne vorher zu signalisieren, dass sie von einem solchen Vorhaben Abstand zu nehmen bereit sind, wenn dies die konkreten Umstände der Situation erfordern sollten. Andernfalls fühlen sich die Eltern des behinderten Kindes schlichtweg „im Stich gelassen“. Entsprechendes gilt, wenn sich Angehörige oder Freunde - gegebenenfalls aus eigener Unsicherheit, Befangenheit oder aus Angst, nicht die richtigen Worte für die Situation zu finden, - sich tage- oder gar wochenlang überhaupt nicht melden oder gar so tun, als sei nichts gewesen. Deshalb mag stilles Mitleiden oder Verharren in Befangenheit zwar als Ausdruck eigener Hilflosigkeit verständlich sein. Es überlässt jedoch betroffene Eltern letztlich sich selbst und wird von ihnen als eindeutiges Versagen des Unterstützungssystems des Freundes- bzw. Familienkreises empfunden, können sich doch Freundschaften oder familiäre Bindungen gerade nur in Krisensituationen wirklich bewähren. Besonders prekär wirkt sich ein „stilles Leiden“ von Angehörigen oder Freunden dann aus, wenn es von Handlungen begleitet wird, die sich aus der Sicht Betroffener geradezu als Verleugnung ihrer eigenen Trauer darstellen, so etwa wenn aus dem Urlaub verschickte Postkarten sich in einer Darstellung von Urlaubsfreuden erschöpfen und deshalb das Isolationsgefühl der Betroffenen noch steigern. Eine entsprechende Wirkung zeitigt ein Verhalten, das beim Trauernden den Eindruck erweckt, es werde von ihm erwartet, er müsse sofort zur Tagesordnung übergehen, weil man ja „ohnehin nichts mehr daran ändern könne“, zumal „es Schlimmeres gebe“. Als besonders rücksichtslos wird ein Verhalten empfunden, durch das ein Gesprächspartner die vom Trauernden selbst angesprochenen Aspekte übergeht, indem er dem artikulierten Leid ausschließlich oder in erster Linie Belanglosigkeiten oder gar freudige Ereignisse aus dem anderen Leben (wie etwa eine Schwangerschaft) entgegen setzt, an denen der Trauernde in seiner isolativen Situation nicht teilhaben kann. Die beschriebenen Verhaltensweisen wirken jedenfalls ignorant auf denjenigen, der nur kurze Zeit vorher die Diagnose erfahren hat, deswegen mehr oder weniger desorientiert ist und damit erst einmal von anderen Menschen dort abgeholt werden muss, wo er sich emotional befindet. Insofern unterscheidet sich die Situation nicht grundlegend von derjenigen, in der sich Angehörige beim Verlust ihnen nahestehender Menschen befinden. In diesem Zusammenhang sei angemerkt: Dritte können, wenn sie sich auf ein gesundes Taktgefühl beziehen, in der beschriebenen Situation grundsätzlich nichts falsch machen, wenn sie einfach nur signalisieren, dass sie jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und das Thema auch sie innerlich beschäftigt. Betroffene Eltern erwarten grundsätzlich nicht, dass ihnen Angehörige oder Freunde praktische Ratschläge erteilen oder für sie Problemlösungsstrategien entwickeln. In erster Linie entscheidend ist vielmehr zum Ausdruck kommende emotionale Anteilnahme: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Bereits ein Tag nach der Diagnose (am 27. August 2005) nahmen wir erstmals Kontakt zur „Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom in Deutschland e.V.“ auf. Meine Frau rief den Vorsitzenden der „Regionalgruppe Thüringen-Sachsen“ an und holte fernmündlich erste Informationen über den Verein und weitere Ansprechpartner ein. Schon drei Tage nach der Diagnose (am 29. August 2005) beantragten wir die Mitgliedschaft im Verein. Den Beitritt haben wir bis heute nicht bereut. Die persönlichen Kontakte, die wir auch über den Verein haben schließen können, haben uns bei der Trauerarbeit und der Bewältigung von durch die Behinderung unserer Tochter bedingten Konfliktlagen sehr geholfen. Diese Kontakte sind ein wesentlicher Teil eines sich nunmehr immer stärker entwickelnden Netzwerkes, das uns die erforderliche persönliche und fachliche Orientierung und Beratung auch für die Zukunft bietet.
Nach dem bei Teresa im Alter von 2 Jahren (2005) eingetretenen Entwicklungsstillstand und der schließlich ab einem Alter von ca. 2 ½ Jahren (ab Sommer 2005) eingesetzten Regression (Phase 2), in deren Zuge motorische Fähigkeiten - wie insbesondere der Handgebrauch - verloren gegangen waren, die Handstereotypien sich immer stärker herausgebildet hatten und Teresa u.a. auto- und fremdaggressive Verhaltensweisen zeigte, war - schon aus präventiven Gründen - eine Intensivierung von Therapiemaßnahmen dringend geboten. Die erforderlichen Maßnahmen der Frühförderung gehen bei Kindern mit Rett-Syndrom über reguläre heilpädagogische Konzepte hinaus. Weder an unserem damaligen Wohnort (Stadtroda) noch in deren näheren Region gab es eine Kindertageseinrichtung, die den besonderen Anforderungen an die Förderung unserer Tochter genügt hätte. Um Teresa die bestmögliche heilpädagogische Förderung zukommen zu lassen, entschlossen wir uns bald, alles daran zu setzen, ihre Aufnahme in die dafür beste (integrative) Kindertageseinrichtung in Jena zu erreichen. Hieran war uns umso mehr gelegen, als in der Einrichtung bereits ein Mädchen mit „Rett-Syndrom“ betreut wurde, das nur knapp ein halbes Jahr älter als Teresa ist. Insofern bestanden dort schon erste Erfahrungen mit der Betreuung und Förderung eines solchen - zudem gleichaltrigen - Kindes. Es handelt sich um Lilly, die Tochter der Krankenschwester (Simone), die wir bereits in der Kinderklinik des Universitätsklinikums Jena im Mai kennengelernt hatten und die nur kurze Zeit nach diesem stationären Aufenthalt - wohl im Juni/Juli (2005) - die Diagnose hinsichtlich ihrer eigenen Tochter erfahren haben dürfte. Solche Wiederbegegnungen stimmen einen stets nachdenklich. Manchmal fragt man sich in solchen Situationen, ob „Zufall“ nicht lediglich eine Fiktion ist, eine gedankliche Konstruktion, deren sich der Mensch bedient, weil er die tatsächlichen inneren Zusammenhänge zwischen Ereignissen nicht vollständig zu erfassen vermag. Jedenfalls stellte der Umstand, dass schon ein anderes Rett-Mädchen im Alter von Teresa die Einrichtung besuchte, für uns geradezu einen „Glücksfall“ dar. Denn angesichts der Seltenheit der Erkrankung (Häufigkeit: 1: 10.000 bis 1: 15.000 Mädchen) und der Vielzahl von in der Wissenschaft ungeklärten Fragen bezüglich der Erlebniswirklichkeit der betroffenen Kinder musste unbedingt gewährleistet werden, dass beide Mädchen in ein- und derselben Einrichtung betreut werden. Diese Erwägungen veranlasste die Stadt Jena, Teresa in die genannte Einrichtung aufzunehmen, obwohl dies im Hinblick auf die Zahl der bereits dort belegten Plätze an sich nicht zu vertreten gewesen wäre. Wegen der Dringlichkeit - Teresa befand sich bereits in der sogenannten Phase 2, in deren Verlauf bereits erworbene motorische Fähigkeiten (wie Greifen, Stehen etc.) wieder verlernt werden, - entsprach die Stadt Jena sehr kurzfristig dem Antrag auf Aufnahme in die Kindertagesstätte, so dass Teresa schon ab 1. November (2005) den Kindergarten besuchen konnte. Die Aufnahme in der Einrichtung und die entsprechende Bewilligung von Eingliederungshilfe setzten jedoch voraus, dass wir unseren Wohnsitz von Stadtroda nach Jena, in den Zuständigkeitsbereich des Einrichtungsträgers, verlegten. Wir mieteten ein Reihenendhaus in einem Ortsteil (Cospeda) von Jena an und zogen Ende Dezember 2005 um. Mit dem Umzug hat sich zugleich meine tägliche Fahrtstrecke zur Dienststelle auf 20 km (Jena-Weimar) verkürzt.
Dieser positive Nebeneffekt ist jedoch mehr ein „Wermutstropfen“ angesichts unserer ursprünglichen Lebensplanung, der die Diagnosemitteilung zunächst die Grundlage entzogen hat. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht verschweigen, dass wir ohne die Diagnose „Rett-Syndrom“ niemals einen Umzug nach Jena erwogen hätten. Denn wir führten bereits zum damaligen Zeitpunkt Vertragsverhandlungen mit einer Architektin über die Planung eines Einfamilienhauses in der Stadt Weimar. Schon am 25. Mai 2005 hatten wir dort ein Baugrundstück erworben. Die Vertragsverhandlungen mit der Architektin mussten wir nach der Diagnose abbrechen, weil wir das Bauvorhaben, solange Teresa die Kindertageseinrichtung in Jena besucht, zurückgestellt haben, da wir während dieser Zeit auch dort wohnen müssen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass keine der in Weimar vorhandenen Kindertages- und Fördereinrichtungen unserer Tochter eine optimale Betreuung und Förderung hätte bieten können. Das trifft auch für den dortigen Waldorf-Kindergarten zu, in den Teresa für die Zeit ab 1. September 2005 schon aufgenommen war; nach Mitteilung der Diagnose meldeten wir sie dort sofort wieder ab.
Im Anschluss an die Diagnose, die eine wesentliche Zäsur in unserem Leben bildet, war damit neben den üblichen Anstrengungen mit einem behinderten Kind der Wohnungsumzug zu organisieren, der uns nahezu die letzte Kraft raubte. Hinzu kam, dass diese Vorbereitungen zeitlich in das Anfangsstadium der Trauerphase fielen. So ganz zwischendurch leisteten wir uns Dinge, die ich aus heutiger Sicht einfach nur als Ausdruck eines „Nichtwahrhabenwollens“ deute: Da die Schulmedizin keine Therapie anbieten kann, saugten wir im Verlaufe der ersten Monate nach der Diagnose alles auf, was uns noch als Ansatz für ein letztes Stück Hoffnung dienlich erschien. Wir beschäftigten uns mit allerlei Richtungen von Alternativmedizin. Eingeschlossen war eine 14-tägige Reise zu einem Heiler (Rolf Drevermann) nach Ibiza, die wir noch im November (2005) antraten. Meine Mutter war so nett, uns bei dieser Reise zu begleiten und Teresa, die damals gerade eine sehr agressive Phase durchlebte, mitzubetreuen. Die hiermit verbundenen organisatorischen und körperlichen Anstrengungen waren für uns alle so groß, dass wir dies nicht als Erholungsurlaub empfinden konnten. Es wäre dümmlich, den Sinn solcher Unternehmungen allein am äußeren tatsächlichen Erfolg zu beurteilen. Solcherlei Aktionen sind schon hilfreich, um die erste Zeitspanne nach dem „Verlust“ zu überstehen. Sie vermitteln einem den Eindruck, der Situation nicht einfach hilflos ausgeliefert zu sein, sondern sie gestalten zu können. Sie können deshalb vorübergehend als Therapieersatz wirken und erfüllen insofern durchaus auch einen praktischen Zweck.
Eine schreckliche Zeit für uns war Weihnachten 2005. Wir saßen - alleine zu dritt - zwischen Umzugskisten. Das neue Haus reizte uns auch nicht besonders. Eine spürbare Verbesserung der Wohnsituation war aus anfänglicher Sicht mit dem bevorstehenden Umzug nicht verbunden. Dieser beruhte ausschließlich auf der Notwendigkeit, Teresa den Besuch einer optimalen Einrichtung zu ermöglichen. Hinzu kam, dass uns schon vor dem Umzug klar war, dass auch das neue Haus nur eine Übergangslösung würde sein können, weil es nicht behindertengerecht ausgestattet war. Schon im Hinblick darauf, dass sich der Wohnbereich auf über drei Etagen erstreckt, ist es für uns auf Dauer nicht geeignet. Aber etwas anderes war in der knapp bemessenen Zeit, die uns zur Verfügung gestanden hatte, eben nicht zu finden. In Anbetracht dieser Umstände waren wir noch kurz vor dem Umzug frustriert und fühlten uns insbesondere am Heiligen Abend (2005) sehr einsam und verlassen. Zudem waren wir völlig ausgebrannt. Wir hatten zwar schon alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen für den Umzug (am 28. Dezember 2005) getroffen, fragten uns aber, woher wir noch die Kraft für die letzten Vorbereitungen nehmen sollten. Wir hatten ein Umzugsunternehmen beauftragt; doch das Verpacken des Transportguts stellte nochmals eine besondere Herausforderung dar. Denn in den acht Jahren, die wir in unserer Doppelhaushälfte in Stadtroda gewohnt hatten, hatte sich eine riesige Menge an Hausrat angesammelt. Im Zustand seelischer, geistiger und körperlicher Erschöpfung empfanden wir damals alles nur noch anstrengend. Hilfe beim Umzug boten uns lediglich meine Eltern an. Auch wenn wir das Angebot zu schätzen wussten, machten wir davon keinen Gebrauch. Effektive Hilfe hätten meine Eltern im Wesentlichen nur durch Betreuung von Teresa leisten können. Dies hätte aber - zumal angesichts der damaligen schwierigen Phase von Teresa - einer aufwendigen Anleitung und Einweisung unsererseits bedurft. Wieder einmal erklärte sich unsere Nachbarin, Frau Klopfleisch, bereit einzuspringen. Sie kennt Teresa seit deren Geburt, betreute sie schon vorher häufig und ist mit deren Eigenarten bestens vertraut. Angesichts der aufgebauten Bindungen muss sie inzwischen als „stille Begleiterin“ von Teresa bezeichnet werden. Am Umzugs- und darauffolgenden Tag betreute sie Teresa in ihrem eigenen Haus. Wir sind ihr noch heute sehr dankbar dafür.
Solange Teresa den Kindergarten in Jena besucht, werden wir dort wohnen bleiben. Ich bin noch heute froh, dass ich auf den Wunsch meiner Frau, Teresa in der besagten Einrichtung anzumelden, Rücksicht genommen und dafür auch Unbequemlichkeiten - wie den zusätzlichen Umzug und den Verzicht auf die Möglichkeit, am Ort meines Arbeitsplatzes wohnen zu können - in Kauf genommen habe. Uli kennt aufgrund beruflicher Erfahrungen als Erzieherin und Heilpädagogin sehr viele Einrichtungen im Raum Jena - auch von innen -. Sie weiß, welche erheblichen qualitativen Unterschiede zwischen einzelnen Einrichtungen dort bestehen. Die integrative Kindertageseinrichtung „Kochstraße“, für die wir uns entschieden haben und in die Teresa glücklicherweise aufgenommen worden ist, nennt sich nicht nur „integrativ“. Insofern unterscheidet sie sich von vielen anderen sogenannten integrativen Kindertagesstätten, bei denen - nach meinem Eindruck - eher Imagepflege als das tatsächliche Bemühen, den Integrationsgedanken auch praktisch umzusetzen, im Vordergrund steht. Bei vielen solcher Einrichtungen ist. In der „Kochstraße“ ist das behinderte Kind nicht nur Mittel zum Zweck. Behinderte Kinder werden dort in einer Weise betreut, die woanders ihresgleichen sucht. Die Betreuungssituation insbesondere für schwerbehinderte Kinder ist beispiellos. Das Engagement geht dort so weit, dass sogar versucht wird, Krankenhauspersonal zu rekrutieren, um selbst schwerstbehinderten Kindern - wie etwa solchen, deren Atmung ständig überwacht werden muss - den Besuch des Kindergartens und damit ein Minimum an Alltagsnormalität sowohl den betroffenen Kindern als auch deren Eltern zu ermöglichen. Für schwer- und schwerstbehinderte Kinder ist grundsätzlich eine 1:1-Betreuung gewährleistet. Eine Physiotherapeutin ist in der Einrichtung fest angestellt. Jeden Tag werden in den Räumlichkeiten der Einrichtung Physiotherapie oder Logopädie angeboten. Und dann schließlich ein ganz wesentlicher Punkt: Die Betreuung und Förderung ist von Liebe getragen. Das Engagement der Angestellten geht weit über das hinaus, was man - zumal angesichts der in unserer Gesellschaft üblichen schlechten Bezahlung qualifizierten Personals - erwarten kann. Nicht zuletzt aufgrund Ulis beruflicher Erfahrungen weiß auch ich die Leistung der Erzieherinnen und Heilpädagoginnen in einer solchen Einrichtung zu schätzen.
Gerade Teresa hat mit ihrer Heilpädagogin (Uta), die sie im Kindergarten von Beginn an liebevoll betreut und außerordentlich gefördert hat, sehr viel Glück. Die Liebe, mit der sie Teresa begegnet, ist auch für uns spürbar und geradezu überwältigend. Sie ist ihr emotional so nahe, dass sie mitunter abends bei uns zuhause anruft, um sich nach dem Wohlbefinden von Teresa zu erkundigen, wenn es unserer Tochter einmal tagsüber im Kindergarten nicht so gut gegangen ist. Das, was diese Pädagogin für Teresa und damit auch für uns tut, ist unbezahlbar. Es ist gerade auch diese besondere tagtägliche Fürsorge für unsere Tochter, die uns glücklich macht und uns das Gefühl gibt, dass Teresa mit all ihren Handicaps in der Einrichtung uneingeschränkt angenommen und im echten Sinne integriert ist. Von Beginn an ist Teresa auch ersichtlich gerne in den Kindergarten gegangen. Heimweh gab es bei ihr selbst am Anfang nicht. Jeden Morgen ist sie Feuer und Flamme, wenn wir sie dorthin fahren. Als Eltern fühlen wir uns dann schon fast abgeschrieben. Sobald sie merkt, dass wir sie in den Kindergarten fahren, strahlt sie über alle Backen. Wegen ihres starken freudigen Ausdrucks gilt sie als Sonnenschein im Kindergarten. Kaum sieht sie Kinder, lacht sie sie an. Die Reaktionen der anderen Kinder fallen entsprechend aus. Sobald sie sie sehen, begrüßen sie sie euphorisch. Jedes Kind im Kindergarten, egal welcher Gruppe es dort angehört, kennt deshalb Teresa.
Sobald unsere Tochter schulpflichtig ist, sind wir nicht mehr an einen bestimmten Einrichtungsort gebunden. Denn Teresa wird voraussichtlich einmal eine spezielle Förderschule besuchen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt werden wir dann wahrscheinlich unser ursprüngliches zeitweilig auf Eis gelegtes Vorhaben - Errichtung eines Eigenheims in Weimar - wieder aufgreifen. Schon wegen der behindertengerechten Ausstattung, auf die wir ab einem bestimmten Alter von Teresa nicht mehr werden verzichten können, werden wir nicht umhin kommen, unser Wohnumfeld diesen praktischen Notwendigkeiten anzupassen. Zur Errichtung eines eigenen Hauses gibt es insofern kaum eine Alternative. Da wir das erworbene Grundstück in Weimar nicht sogleich nach der Diagnose wieder verkaufen wollten, wird dieser Ort wahrscheinlich doch unser neues Domizil werden. Letztlich aber entscheidend dafür werden in erster Linie die unterschiedlichen Optionen im Hinblick auf für Teresa geeignete Schulen sein.
Einige Wochen nach dem Umzug von Stadtroda nach Jena lief die dreijährige Elternzeit von Uli ab. Bis zur Geburt von Teresa (21. Februar 2003) hatte sie als Heilpädagogin in einer Grundschule eines privaten Trägers gearbeitet. Wegen Teresas Behinderung hat sie zunächst - bis Mitte 2008 befristeten - unbezahlten Sonderurlaub in Anspruch genommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Dinge weiter verändern werden.
Inzwischen liegt der Umzug von Stadtroda nach Jena über ein Jahr hinter uns. Nachdem wir im Verlaufe der ersten drei bis dreieinhalb Lebensjahre von Teresa sehr viel Kraft haben aufbringen müssen, um die Sorgen um unsere kleine Tochter zu bewältigen und die damit im Zusammenhang stehenden Erschwernisse des Alltags zu meistern, ist die Alltagssituation innerhalb des letzten halben Jahres deutlich entspannter geworden. Es sind nunmehr über anderthalb Jahre vergangen, seitdem uns die Diagnose „Rett-Syndrom“ mitgeteilt worden ist. Seitdem wir Klarheit haben, geht es uns deutlich besser. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt - nach einem dreiwöchigen Kuraufenthalt von Teresa und Uli und einigen Wochen Erholungsurlaub im letzten Jahr (2006) - ein Stadium erreicht haben, das man vielleicht mit spürbarer physischer und psychischer Stabilisierung zutreffend umschreiben könnte.
Weiterhin haben wir den Eindruck, dass wir den „Verlust“ inzwischen seelisch weitgehend akzeptiert haben. Vielleicht ist uns dies deshalb nicht ganz so schwer gefallen, weil wir möglicherweise von Anfang an innerlich darauf vorbereitet waren.
Ich kann nicht ausschließen, dass in unserem Unterbewusstsein die Erkenntnis, ein besonderes Kind zu haben, schon sehr früh vorhanden war. Ich erinnere mich grob an einen Traum, den ich nur wenige Monate nach Teresas Geburt hatte: Ich träumte von unserem Nachwuchs. Ein kleines Baby stand im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Dieses Baby verstarb sehr früh aus nicht nachvollziehbaren Gründen. An seiner Stelle trat dann ein anderes Baby. Es bestand für uns kein Zweifel daran, dass auch dieses andere Baby unser Kind war. Es war aber kein Neugeborenes, sondern hatte von Anfang die Größe und den Entwicklungsstand, den das erste Baby bereits erreicht hatte, als dieses verstarb.
Unmittelbar nachdem ich die Geschichte geträumt hatte, konnte ich sie noch nicht deuten. In ihm drückt sich vielleicht dieselbe Vorahnung aus, die meine Frau wohl etwa zum selben Zeitpunkt gehabt haben dürfte und von der sie mir erst später erzählt hat: Als sie einmal zusammen mit Teresa - im Kinderwagen liegend - in unserem damaligen Wohnort (Stadtroda) allein in Ruhe spazieren ging, verspürte sie plötzlich in sich eine rational nicht begründbare innere Gewissheit, deren Inhalt Uli mit folgenden Worten beschreibt, die sie damals in Gedanken gegenüber Teresa ausgesprochen haben will: „Jetzt sieht man es Dir noch nicht an, dass Du ein Handicap hast, aber Mama weiß es.“
Was unsere kleine Familie jetzt angeht:
Uli und ich sind glücklich, dass wir Teresa haben und sie genau so ist, wie sie ist. Wir können uns deshalb ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie ist ein ausgesprochen fröhliches Kind mit sehr viel Temperament. Wir glauben, sie hat sehr viel Spaß an ihrem Leben, vielleicht gerade weil sie ein „Rett-Mädchen“ ist und deshalb Zugang zu einer Erlebniswirklichkeit hat, die uns selbst letztlich immer verschlossen bleiben wird. Wir lieben sie ohne Wenn und Aber, vielleicht sogar noch ein Stück mehr, als wenn sie kein „Engelchen“ - ohne Rett-Syndrom - wäre. Teresa sich etwa ohne Rett-Syndrom vorzustellen, liefe auf eine Fiktion hinaus, weil das Rett-Syndrom Teil von Teresa ist, ihren Liebreiz prägt und sie zum „Engelchen“ macht. An gegenläufigen Wunschvorstellungen festzuhalten, wäre überdies nicht zuletzt auch Ausdruck der Unfähigkeit, einen Menschen so zu akzeptieren, wie er geschaffen worden ist – vom Lieben Gott.
Unser „Engelchen“ hat uns zu einem Perspektivenwechsel verholfen, der unser Leben bereichert hat und für den wir dankbar sind. Vieles von dem, wie wir früher manches gesehen und was wir für richtig gehalten haben, erscheint uns aus dieser neuen Perspektive eindimensional. Früher wäre für mich ein Leben mit einem behinderten Kind nicht vorstellbar gewesen. Heute ist es umgekehrt - ohne „Behinderung“ - nicht mehr vorstellbar. Ein nunmehr auch emotional fundiertes Verständnis können wir erst jetzt aufbringen für die weisen Worte des früheren Bundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker: „Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern eine Gnade...“.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
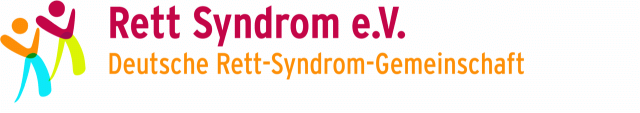
 Es hat aber viel Spaß gemacht, Eure Geschichte zu lesen. Chris und ich haben einige Paralellen feststellen können! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben Uli schon in Bayfreuth auf dem Therapeutentreffen kennengelernt. Kann das sein?
Es hat aber viel Spaß gemacht, Eure Geschichte zu lesen. Chris und ich haben einige Paralellen feststellen können! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben Uli schon in Bayfreuth auf dem Therapeutentreffen kennengelernt. Kann das sein? 

 Fühlt euch von mir gedrückt ...
Fühlt euch von mir gedrückt ...  Theresa
Theresa